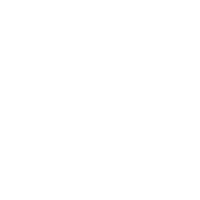Nachrichten
„Mit Maria Christus näher kommen“ – Schönstatt-Theologen im Gespräch über das neue Vatikan-Dokument „Mater populi fidelis“

„Mit Maria Christus näher kommen“ - darum geht es der Schönstatt-Bewegung; Das Gnadenbild der Dreimal Wunderbaren Mutter von Schönstatt zeigt Jesus im Mittelpunkt, den Maria den Menschen anbietet (Foto: POS-Archiv)
Hbre. Am 20. November 2025 trafen sich mehrere Theologen aus der Schönstatt-Bewegung in einer Online-Runde um sich über das neue Schreiben „Mater populi fidelis“ des Dikasteriums für die Glaubenslehre auszutauschen. Zu diesem Onlinegespräch hatte Pater Felix Geyer, Leiter der Schönstatt-Bewegung Deutschland, Pater Ludwig Güthlein, Schwester M. Aloisia Levermann, Pater Hans-Martin Samietz und Pater Lukasz Pinio eingeladen, um Fragen, die dieses Schreiben in der marianischen Spiritualität auslöst, zu sondieren. Die lehrmäßige Note klärt einige marianische Titel wie „Miterlöserin“ und „Mittlerin“ und hat in der Schönstatt-Familie – wie in vielen anderen kirchlichen Kreisen – Fragen und z. Teil „pastorale Verunsicherung“ ausgelöst. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Frage: Wie kann die marianische Spiritualität Schönstatts noch deutlicher in ihrer Christuszentriertheit und menschlich-pädagogischen Wirksamkeit erlebt und kommuniziert werden?
Ein neues Dokument – und viele Fragen
Die Note „Mater populi fidelis“ („Mutter des gläubigen Volkes“) wurde am 4. November 2025 veröffentlicht. Sie will nach eigener Aussage auf zahlreiche Anfragen zur Marienverehrung antworten und genauer bestimmen, in welchem Sinn bestimmte Titel Marias angenommen werden können und in welchem nicht. Gleichzeitig möchte sie den Platz Marias im Licht Christi als „einzigem Mittler und Erlöser“ klären, bei großer Treue zur katholischen Identität und mit ökumenischer Sensibilität.

Zu einem theologischen Austausch über das neue Schreiben „Mater populi fidelis“ hatte Pater Felix Geyer, Leiter der Schönstatt-Bewegung Deutschland (oben links), eingeladen (Foto: Bildschirmfoto)
Öffentlich besonders wahrgenommen wurde, dass der Vatikan empfiehlt, möglicherweise irreführende Titel wie „Miterlöserin“ oder „Gnadenmittlerin“ eher zu vermeiden, weil sie die einzigartige Erlöserrolle Jesu verdunkeln oder Missverständnisse nähren könnten. Mediale Schlagzeilen wie „Vatikan weist übertriebene Marienverehrung in die Schranken“ haben die Verunsicherung zusätzlich verstärkt.
Für eine Bewegung, in der Maria eine zentrale Rolle spielt, ist das keine Randnotiz. „Maria ist ja zu zentral für unsere Spiritualität, als dass wir nicht darauf reagieren“ könnten, fasst Pater Felix den Anlass für das Gespräch zusammen. Zugleich spürt er in seinen Kreisen und Besuchen in den verschiedenen Regionen und Projekten der Bewegung eine „pastorale Ambivalenz, Spannung und Unsicherheit: Was darf man denn eigentlich noch über Maria sagen?“

Pater Ludwig Güthlein ISch (Bildschirmfoto)
Erste Reaktionen: Befremden, Traurigkeit – und Anerkennung
In einer ersten Runde schilderten die Teilnehmenden ihre persönlichen Eindrücke. Pater Ludwig Güthlein berichtet, er habe die Note zunächst „sehr schnell“ gelesen und sei „ein bisschen traurig“ gewesen: Die pastorale Absicht sei zwar erkennbar, aber der Text wirke eher „lähmend für die Marienverehrung“.
Schwester M. Aloisia Levermann, die über Marias Mitwirken am Heil wissenschaftlich gearbeitet hat, war vor allem überrascht, „dass man da heute eine lehramtliche Aussage machen muss“, vor allem angesichts eines stark abgrenzenden Tons zwischen Christus und der Gottesmutter. Erst beim zweiten Lesen würden „Nuancen“ des Textes deutlicher und würde die eigentliche Absicht des Dokumentes sichtbarer.
Gleichzeitig konnten die Diskutanten jedoch auch positive Akzente benennen. Pater Güthlein betonte: „Es ist gut, dass wir von Anfang an eine dogmatisch klare Mariologie hatten.“ Schönstatt habe nie gelehrt, Maria stehe in vergleichbarer Weise wie Christus im Erlösungswerk: „Sie ist selbst die Erst-Erlöste und Voll-Erlöste.“ Schon in der Überschrift gehe es der Note um die richtig verstandene „Mitwirkung Marias am Heilswerk“. Die Entfaltung dieser Mitwirkung in den ersten Kapiteln sei sehr hilfreich. „Es geht um die doppelte Perspektive der Mitwirkung Marias ‚an der objektiven Erlösung, … und dann im Hinblick auf ihren heutigen Einfluss auf die Erlösten‘ [4]“. Das sei ein wichtiger Anknüpfungspunkt für Schönstatt.
Christus im Zentrum – mit Maria
Sehr wichtig sei, dass das neue Dokument die Christuszentrierung besonders ins Zentrum stelle. Pater Güthlein formuliert es sehr deutlich: „Ich bin absolut überzeugt, dass wir deutlich mehr und entschiedener von ‚Christus und Maria‘ und ‚Maria und Christus‘ reden müssen.“ In einer Zeit, in der die Selbstverständlichkeit des Glaubens nicht mehr gegeben ist, müsse jede Marienverkündigung transparenter in eine klare Christusverkündigung eingebettet sein: Sakramente, Schrift, Anbetung und Beziehung zum dreifaltigen Gott könnten heute vielfach nicht mehr als „Hintergrund“ vorausgesetzt werden.

Schwester M. Aloisia Levermann (Bildschirmfoto)
Gleichzeitig bestehe natürlich die Gefahr, dass Maria nur noch als Randfigur gesehen werde. Pater Felix erinnerte daran, dass gerade der marianische Weg der Schönstatt-Spiritualität den Alltag mit Christus verbinde: „Ich habe den Eindruck, unser Schönstätter Weg ist eben der im Alltag. Und dafür steht par excellence das Marianische.“ Maria helfe, Christsein konkret zu leben, im Beruf, in Beziehungen, im Umgang mit Freiheit und Verantwortung.
Schwester Aloisia sprach von einer „organischen Sicht“ auf Maria: Diese führe nicht von Christus weg, sondern hinein in den Erlöser. Die Sorge, die Beziehung zur Gottesmutter könnte Christus verdecken, sei „eigentlich nicht wirklich unsere Sorge oder die Sorge unseres Vaters“, also des Gründers Pater Kentenich. Eher sehe Schönstatt als Teil der Kirche eine Sendung darin, das Marianische als Weg zu Jesus Christus neu zu entdecken.
Gnade, Mitwirkung und die Beiträge im Liebesbündnis, die für Schönstatt zentral sind
Ein weiterer Schwerpunkt der Diskussion war die Frage: Was heißt eigentlich „Mitwirken Marias am Heilswerk“ und wie lässt sich das für Nichttheologen verständlich sagen?

Pater Lukasz Pinio ISch (Bildschirmfoto)
Pater Lukasz Pinio wies zunächst auf eine Grundunterscheidung hin: Wenn das Dokument von „Gnade“ spreche, meine es teils die grundlegende Beziehung des Menschen zu Gott (die „unerschaffene Gnade“), teils die konkreten Gaben des Heiligen Geistes im Alltag. Für Schönstatt sei es wichtig, beides zusammenzudenken: Maria ist die zuerst und ganz Erlöste und zugleich jene, durch die Gottes Geist konkret im Leben der Menschen wirksam wird.
Schwester Aloisia plädiert dafür, Gnade nicht „sachhaft“ zu verstehen, „als Paket, das ich von rechts nach links transportiere“, sondern „von der Liebe her“. Gnade sei letztlich Beziehungsereignis: Liebe Gottes, die den Menschen verwandelt, und menschliche Liebe als Antwort. In diesem Licht könne auch Mittlerschaft verstanden werden, als „liebendes Ineinander“, in dem Maria Menschen in den Raum der göttlichen Liebe hineinzieht, damit sie als Kinder Gottes leben.
Schönstatts Beitrag: Erfahrung, Sprache und Pädagogik

Pater Hans-Martin Samietz ISch (Bildschirmfoto)
Dass das Dokument die Mitwirkung des Menschen und die besondere Stellung Mariens klar benennt, wurde im Gespräch der Schönstatt-Theologen positiv unterstrichen. Pater Hans-Martin Samietz betonte, dass Marienverehrung am besten ekklesiologisch gedacht werde: Maria als Teil des Leibes Christi, eng verbunden mit Christus dem Haupt, und inmitten der Kirche. So lasse sich auch das Schönstatt-Liebesbündnis verstehen: als Bündnis innerhalb des großen Bündnisses Gottes mit seinem Volk. Zugleich wies er darauf hin, dass Schönstatt nicht nur eine „fromme Volksbewegung“, sondern auch eine theologische Schule sei, manchmal mit eigenen Begriffen, die immer wieder neu übersetzt werden müssten.
Mehrfach tauchte der Gedanke auf, dass das Gespräch über „Mater populi fidelis“ für Schönstatt ein Arbeitsprogramm eröffne: Es gehe darum Begriffe zu klären, Bilder zu erneuern, das eigene Erbe Pater Kentenichs kritisch und dankbar neu zu lesen und vor allem alles so ins Wort zu bringen, dass es heutigen Menschen für ihr Alltagsleben helfe. „Wir müssen lernen, Begriffe nicht nur als Worte zu benutzen, die wir einfach irgendwann mal gelernt haben“, sagte Schwester Aloisia. Sonst drohe, dass kostbare Inhalte leer laufen könnten.

Pater Felix Geyer ISch (Bildschirmfoto)
Sicherheit geben – nicht kleinlaut werden
Am Ende des Abends stand kein fertiges Positionspapier, sondern eher eine gemeinsame Richtung. Pater Felix Geyer formulierte sie so: Es gehe darum, den Menschen in der Bewegung erkennen zu helfen, „dass man freudig über Maria sprechen kann – vielleicht sogar muss – gerade angesichts der Zeit“, und gleichzeitig die einzigartige Mitte Jesus Christus klar ins Licht zu stellen. Pater Güthlein brachte den doppelten Auftrag auf den Punkt: „Wir wollen einerseits ganz in der Lehre der Kirche sein, ohne Zusatzerkenntnisse oder Offenbarungen. Aber wir haben als Weg einen marianischen Spiritualitätsweg, von dem wir der Meinung sind, dass er der Kirche helfen kann.“ Die Note schlage im Blick auf Maria und für die Kirche überhaupt die Formulierung „teilnehmende Mittlerschaft“ vor. „In Schönstatt haben wir erlebt, wie fruchtbar eine solche marianische Prägung des Alltags wird. Eine lebendigere Christusbeziehung und eine wachsende Wachheit für das Wirken des Heiligen Geistes ist der ‘Massstab‘ und die Perspektive, die die Note betonen will, ist auch für uns die innere Zielrichtung unserer Spiritualität.“
„Das kleine Symposium diente der Sondierung und Sortierung der verschiedenen Ebenen und aktuellen Fragen“, so Pater Felix Geyer. In geeigneten Formaten (Schönstattkonferenz, Fortbildungen, Artikel in der Zeitschrift Regnum) werde eine vertiefende Weiterarbeit und Bearbeitung einzelner Akzente erfolgen.