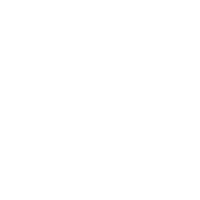Nachrichten
Widerstandsfähigkeit in politischer Bedrängnis – Das Schönstatt-Heiligtum von Friedrichroda, ein Ort der Heimat in der Fremde

Das Schönstatt-Heiligtum von Friedrichroda wurde am 28. Oktober 1954 eingeweiht (Foto: Archiv)
CBre/Hbre. In der Online-Seminarreihe des Josef Kentenich Instituts (JKI) zum Thema „Schönstatt – politisch?“ fand am Sonntagabend, 9. November 2025, ein weiteres Meeting statt, zu dem der Präsident des JKI, Prof. Dr. Joachim Söder, an 54 Computerbildschirmen, vor denen häufig zwei und mehr Teilnehmende saßen, zwischen 80 und 100 Personen begrüßen konnte. Referent des Seminarabends war der in der früheren DDR aufgewachsene Schönstatt-Pater Hans-Martin Samietz, der sich mit der Bedeutung des Heiligtums in Friedrichroda im Rahmen der Schönstattgeschichte beschäftigte.

Pater Hans-Martin Samietz referierte beim Online-Abend des JKI (Bildschirmfoto)

Professor Dr. Joachim Söder, Präsident des JKI, führte in den Abend ein (Bildschirmfoto)
Ein Ort der Freiheit im Sozialismus
Pater Hans-Martin Samietz lernte Schönstatt 1989 bei einem Zeltlager kennen. Für ihn war dieses Lager ein Raum des Aufatmens inmitten eines Staates, der Glauben und Individualität misstrauisch beäugt habe. Dort habe er als 14-Jähriger zum ersten Mal den „Hunger nach Freiheit“ gespürt, erzählt er. Obwohl er seine Kindheit als glücklich beschreibt, wurde ihm bewusst, wie kostbar Freiheit ist, wenn sie nicht selbstverständlich ist. Für ihn verband sich diese Erfahrung mit dem Schönstatt-Heiligtum in Friedrichroda.
Heimat in der Fremde der Diaspora
Friedrichroda sei einst ein beliebter deutschlandweit bekannter Kurort gewesen. 1934 haben die Schönstätter Marienschwestern das Haus Waldfrieden angeboten bekommen und mit Zustimmung des Schönstatt-Gründers Pater Kentenich begonnen, dort ein Zentrum katholischen Lebens in der Diaspora aufzubauen. Dabei sei es Kentenich von Anfang an darum gegangen, dass vor allem solche Schwestern in der Diaspora eingesetzt würden, die ihre Arbeit selbständig, unabhängig und eigenverantwortlich zu übernehmen in der Lage seien. Schon bald hätten diese Schwestern die Hauskapelle von Haus Waldfrieden nach dem Vorbild des Urheiligtums in Schönstatt eingerichtet, lange bevor es Filialheiligtümer gab. Erst 1954 sei schließlich das heutige Heiligtum etwas unterhalb von Haus Waldfrieden gebaut und eingeweiht worden. Pater Kentenich habe es beschrieben als ein „Zentrum in der Fremde“, als einen Ort, der in der Fremde der Diaspora Heimat schenken sowie Bindungen ermöglichen und Orientierung schenken konnte. Bis 1981 sei diese Schönstattkapelle die einzige auf dem Gebiet des ehemaligen Ostblocks geblieben.

Das Schönstatt-Heiligtum Friedrichroda steht etwas unterhalb von Haus Waldfrieden mitten in einem kleinen Waldgebiet (Foto: Bildschirmfoto)
Ostsendung wider den Bolschewismus
Pater Kentenich erkannte früh die ideologische Gefahr des Bolschewismus, der den Einzelnen der Staatsraison unterordnete. Für ihn war der Verlust der persönlichen Freiheit nicht nur ein politisches, sondern ein spirituelles Problem. Der Bolschewismus – so Kentenichs Analyse – zerstöre das Fundament menschlicher Würde, weil er den Menschen auf seine Nützlichkeit reduziere.

Pater Josef Kentenich bei einem seiner Besuche am Fenster des ehemaligen Provinzhauses der Schönstätter Marienschwestern in Friedrichroda (Foto: Archiv)
Dagegen setzte Kentenich das Ideal des freien, selbstverantwortlichen Menschen, der in seiner Bindung an Gott gerade jene innere Stärke findet, die keine Diktatur brechen kann. Er setzte die so genannte „Ostsendung“ gegen die Ideologisierung durch den Bolschewismus. Schönstatt habe eine Aufgabe, östliches und westliches Denken miteinander zu verbinden. In der russischen Seele stecke „ein ausgesprochener Unendlichkeitsdrang“ hatte der Schönstattgründer am 5. Juli 1951 bei der Übertragung des sogenannten Ostkreuzes ins Urheiligtum formuliert. Dazu komme „ein großes Stück Jenseitsorientierung und Weltentrückung“, während die westliche Seele und das westliche Denken „mehr diesseitsorientiert“ seien, „stärker lebensnah, lebensformend und lebensgestaltend". Für diese „Ostsendung“ hätten sich 30 bis 40 Schönstattpriester aussenden lassen, um im Osten Deutschlands für den Glauben Zeugnis zu geben. Für diese sei das Sterbekreuz des 1943 von den Nationalsozialisten hingerichteten Pallottiners Franz Reinisch, der den Eid auf Hitler verweigert hatte, zum Sinnbild für die Haltung jener Freiheit geworden, die auch im Angesicht totalitärer Systeme standhalte.
Der geheime Schwur auf Freiheit
Auch in der DDR habe dieser Geist weitergelebt. Junge Männer aus der Schönstattbewegung trafen sich heimlich bei Nacht auf einem Berg bei Friedrichroda. Sie breiteten ihre Fahne aus, legten das Reinischkreuz darauf und schworen: „Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, wir wollen frei sein… trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen“ (aus: Friedrich Schiller, Wilhelm Tell). Diese Rituale seien Akte stillen Widerstands gewesen, Ausdruck einer Freiheit, die von innen kam. Das Schönstatt-Heiligtum, in dessen Umfeld diese Haltung gelebt wurde, sei so zu einem geistigen Schutzraum für jene geworden, die sich nicht dem Druck der Gleichschaltung beugen wollten.

JKI-Online-Seminar (Foto: Bildschirmfoto)
Selbstständigkeit als Sendung
Eine weitere Spur im Sinne eines „Schönstatt 2.0“ wollte der Referent legen, als er darauf hinwies, dass Pater Kentenich schon länger vor dem Mauerbau erkannt habe, dass die Schwestern und das Zentrum in Friedrichroda sich möglicherweise ganz unabhängig entwickeln müssten. Tatsächlich war es in der Zeit des Eisernen Vorhanges notwendig, in der Diaspora eigene Formen und Ausdrucksweisen zu finden, ohne die Wurzeln zu verlieren. Es ging um geistige Selbstständigkeit, nicht um Abgrenzung. Pater Kentenich unterstützte Menschen, die lernen sollten, Verantwortung zu tragen, selbst zu denken und eigenständig zu glauben. Freiheit, so sei es Pater Kentenichs Vision gewesen, wachse dort, wo Bindung nicht Zwang, sondern Beziehung bedeute.
Geistige Resilienz heute
Pater Samietz stellte zum Abschluss die Frage in den Raum, warum heute, da die äußere Freiheit gesichert scheine, das geistliche Leben vielerorts erlahme. Vielleicht, so seine Deutung, weil Freiheit ohne Werte beliebig werde. Die Geschichte von Friedrichroda erinnere daran, dass Freiheit immer auch Verwurzelung brauche – in Gott, im Gewissen, in der Gemeinschaft. Der Ort und alles, was sich dort entwickelt habe, sei ein gutes Beispiel dafür, wie Glaube in politischer Bedrängnis widerstandsfähig machen und Menschen, die nicht in Angst, sondern von Überzeugungen lebten, formen könne.