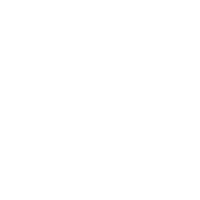Nachrichten
Drei Jahrzehnte Tabor-Heiligtum: Schönstatt-Männer feiern ein Fest der Erinnerung, des Dank und der Sendung

Festmesse am 15. Oktober 2025 anlässlich von 30 Jahren Einweihung des Taborheiligtums auf dem Marienberg (Foto: Dillinger)
Hbre. Mit großer Dankbarkeit feierte die Schönstatt-Männerbewegung am 15. Oktober 2025 das 30. Weihejubiläum des Tabor-Heiligtums auf dem Marienberg. Zahlreiche Vertreter der Schönstatt-Männergemeinschaften, Mitglieder der Schönstattfamilie und Gäste kamen zusammen, um an diesem besonderen Ort Geschichte lebendig werden zu lassen. Kurstreffen des Männerbundes und die Jahrestagung der Schönstatt-Männerliga waren im Vorfeld so geplant worden, dass die Mitglieder der Gemeinschaften gemeinsam feiern konnten. Der Festvortrag stand unter dem Leitgedanken: „Unser Weg als Männer zum Tabor-Heiligtum und dessen Sendung für heute und morgen.“ Joachim Konrad, Leiter des Schönstatt-Männerbundes, begrüßte die Gäste zu dieser Feier.
Vom geistigen Grundstein zur Weihe 1995
In seinem geschichtlichen Überblick zeichnete Alois Steiner den langen Weg bis zum heutigen Jubiläum nach. Schon in den 1930er Jahren habe Pater Josef Kentenich vom Marienberg gesprochen und gesagt, „dass sich dort die Marienbrüder […] einmal niederlassen sollten“. 1945 habe er diesen Gedanken bekräftigt: „Die Schwestern haben ihren Berg und die Marienbrüder ihren Berg.“
Am 29. September 1950 konnten die Marienbrüder auf dem Marienberg ein erstes Gelände im Sinne eines Geburtstagsgeschenkes für den Schönstattgründer Pater Kentenich, erwerben. Fünf Jahre später, an seinem Geburtstag 1955, wurde der geistige Grundstein für das „Männer“-Heiligtum gelegt, 1957 wurde ein erster Bildstock an jener Stelle errichtet, wo heute das Tabor-Heiligtum steht.

Joachim Konrad beim Vortrag im Haus Tabor (Foto: Dillinger)
1967 errichtete das Schönstattinstitut Marienbrüder auf dem Plateau des kleinen Hünerberges, so die Flurbezeichnung, den Mario-Hiriart-Gedenkstein als „vertrauensvollen Dank und als Bitte um seine [Mario Hiriarts] Mithilfe beim Ringen um den Landerwerb“. In den 1970er Jahren begannen Gespräche zwischen Bruno M. Herberger und Dieter Große Böckmann über ein gemeinsames Heiligtum der Männersäule. Es folgte eine Zeit intensiven Suchens, mit Bauwagen, Liga-Gnadenstätte, Bundeshütte und schließlich dem Bau des Jugendzentrums Marienberg.
Nach Jahren eines gefühlten Stillstandes entstand nach der Krönung der Gottesmutter zur „Königin des Marienberges“ am 29. Mai 1994 eine neue Dynamik. Dafür hätten viele Männer ganz viel eingesetzt, bis hin zum Lebensopfer, wenn man an das Beispiel von Herrn Michaletz aus Koblenz denke. „Parallel zu seiner Beerdigung am 20. Januar 1995 bekommt der Architekt die Baugenehmigung für das Tabor-Heiligtum“, so Alois Steiner. Am 15. Oktober 1995 wurde das Heiligtum schließlich eingeweiht.
Das folgende Triduum auf das Jahr 2000 hin zeigt lebendiges Leben: Im Christus-Jahr 1997 kam das Taborsymbol, im Heilig-Geist-Jahr 1998 das Geist-Symbol und im Gott-Vater-Jahr 1999 das Vatersymbol hinzu. 2012 wurden die fünf Säulen der Schönstatt-Mannesjugend Deutschland SMJ vor dem Heiligtum aufgestellt und die Gottesmutter zur „Taborkönigin“ gekrönt.

Ein Wort Pater Kentenichs, handschriftlich festgehalten in der Gründungsurkunde Schönstatts
Marienberg als Bildungsstätte und geistiger Ort
Joachim Konrad stellte im zweiten Teil des Vortrags die Sendung des Marienbergs vor. Schönstatt sei, so betonte er, „eine marianisch geprägte Erziehungsbewegung“. Er griff zwei zentrale Gedanken Pater Kentenichs auf: „Wir wollen lernen, uns unter dem Schutze Mariens selbst zu erziehen zu festen, freien, priesterlichen Charakteren.“ Und aus der Pfingsttagung 1930: „Wir sind dabei, uns selber in den Griff zu nehmen […] Wir selber müssen entzündet werden vom Feuer des Heiligen Geistes.“
Die Gründervision vom Marienberg als „Mittelpunkt der ganzen Männersäule“, als „Bildungsstätte der Jugend und der Erwachsenen und damit das Rückgrat auch einer weitausreichenden Laienbewegung mitten in der Welt“ werde hier deutlich, sagte Konrad. Angesichts einer so großen Vision geäußerte Zweifel habe Pater Kentenich pragmatisch mit „dann fange einmal mit den Handwerkern an“ beantwortet, wie einem Brief von Pater Alexander Menningen, einem Wegbegleiter Pater Kentenichs aus dem Jahr 1949 zu entnehmen sei. So habe der Weg zum Marienberg als einem Ort der Selbsterziehung und der geistigen Bildung begonnen.

Männer treffen sich vor dem Tabor-Heiligtum auf dem Marienberg in Schönstatt, Vallendar (Foto: Ernest Onu)
Geistliche Heimat für Generationen von Männern
Das Tabor-Heiligtum selbst steht für die erfahrbare Seite dieser Sendung. In der Gründungsurkunde heißt es: „Als Petrus die Herrlichkeit Gottes auf Tabor gesehen, rief er entzückt aus: Hier ist wohl sein. Lasset uns hier drei Hütten bauen!“ Diese Worte seien, so Konrad, Ausdruck einer bleibenden Erfahrung: Die Gottesmutter lade hier ein: „Willkommen hier in meinem und eurem Heiligtum; du bist mein geliebter Sohn.“
Peter Hagmann richtete in seinem Beitrag dann den Blick in die Zukunft. Vernetzung und geistige Verbundenheit seien für die Männerbewegung seit ihren Anfängen entscheidend gewesen. „Diese geistige Verbundenheit ist mehr als Vereinsarbeit – sie ist gelebte Spiritualität und Inspiration im persönlichen und beruflichen Umfeld“, sagte er.
Zum Abschluss waren die Teilnehmenden eingeladen, ihre eigenen Erfahrungen mit dem Marienberg zu teilen. Einer der Teilnehmer bekannte: „Aus dem Loch ist Heimat geworden.“ Ein anderer sprach vom Marienberg als „ruhiger Telefonzelle zum Gespräch mit Maria“.
Die Feier endete mit einer Dankmesse im Heiligtum. Ein Satz des Marienbruders Josef M. Grill fasste die Stimmung des Abends zusammen: „Wir dürfen überzeugt sein, der ewige Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind in diesen Berg verliebt.“
Unter Verwendung von
Beiträgen von Alois Steiner, Joachim Konrad und Peter Hagmann,
Schönstatt-Männerbund
Mehr Informationen
- Download Beitrag von Alois Steiner, Joachim Konrad und Peter Hagmann (pdf)