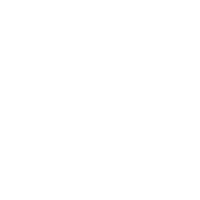Nachrichten
Zwischen Visitation und Vertrauen – Neuer Band dokumentiert Konfliktjahre der Schönstatt-Bewegung

600 Seiten Dokumentation sind zur Reihe "Dokumente zur Geschichte der Schönstatt-Bewegung" mit der im Oktober neu erschienenen Ausgabe des "Studienbandes 4.2" hinzugekommen. Damit umfasst die Reihe jetzt 3612 Seiten oder gut 21 Regalzentimeter (Foto: Brehm)
Hbre. Ein neues Kapitel in der Erforschung der Schönstatt-Geschichte ist aufgeschlagen: Im Oktober ist im Patris Verlag, Vallendar-Schönstatt, die 600 Seiten starke Studienausgabe 4.2 der Reihe „Dokumente zur Geschichte der Schönstatt-Bewegung“ erschienen. Mit diesem Band liegt bereits das neunte Buch der groß angelegten Editionsreihe vor. Es trägt den Titel „Dekrete und Kontroversen um das Schönstatt-Werk“ und versammelt bislang unveröffentlichte Quellen aus den Jahren 1954 bis 1955, einer Zeit, in der die junge Bewegung aufgrund der Verbannung ihres Gründers, Pater Josef Kentenich, in der Spannung zwischen kirchlicher Kontrolle und dem Ringen um Autonomie und Identität stand.
Die Reihe dokumentiert, wie die Schönstatt-Bewegung als weltweit verbreitete geistliche Erneuerungsinitiative in der Mitte des 20. Jahrhunderts die kirchlichen Behörden herausforderte. Herausgeber P. Eduardo Aguirre ISch beschreibt im Vorwort, was diese Dokumentation leistet: „Schritt für Schritt können die Leserinnen und Leser mitverfolgen, wie sich die Kontroversen um das Schönstatt-Werk innerhalb der betreffenden drei Jahre weiterentwickelten.“ Entstanden ist ein faszinierendes Panorama von Konflikten, in dem Macht, Misstrauen, Fragen der Spiritualität und eines neuen geistlichen Weges eng ineinandergreifen.

Im neu erschienenen Teilband 4.2 finden sich 106 Dokumente der auf über 750 Dokumente projektierten Studienausgabe 4. Mit der akribischen Editionsarbeit versuchen der Herausgeber und die Redaktion Forderungen aus der Schönstatt-Bewegung und von außerhalb nach mehr Transparenz der Schönstatt-Geschichte entgegenzukommen (Buch-Cover Studienausgabe 4.2)
Ringen um freie Wahlen
Im Mittelpunkt der Dokumente aus dem Jahr 1954 steht das Generalkapitel der Marienschwestern, und damit ein Lehrstück darüber, wie unterschiedlich die Akteure auf Freiheit und Kontrolle blickten. Die Schönstätter Marienschwestern wollten die neue Generaloberin in freien Wahlen bestimmen. Doch aus Trier und Rom kamen andere Signale: Bischof Wehr, Weihbischof Stein und der Jesuit P. Sebastian Tromp, Konsultor des H.O., zunächst noch Visitator bis Juli 1953, später als Experte des Heiligen Offiziums zuständig für die Sache Kentenichs und Schönstatts, suchten Einfluss zu nehmen. Gemeinsam mit einigen Schwestern aus dem sogenannten „kleinen Kreis“, die gegen Kentenich ausgesagt hatten, entstand ein Netzwerk, das die neue Generalleitung nach eigenen Vorstellungen besetzen wollte.
Was sich in den Dokumenten liest wie ein kirchlicher „Kleinkrieg“, gipfelte in einem ungewöhnlichen Eingreifen des Papstes selbst: Pius XII. stoppte alle Manipulationsversuche und ordnete eine freie Wahl an, allerdings unter der Bedingung, dass die Gewählten „das Vertrauen der Mehrheit der Schwestern besitzen und zugleich in Gehorsam und Treue zur Kirche stehen“. Am 22. Mai 1954 wurde schließlich Schwester Heriberta Roß zur Generaloberin gewählt. Doch die Auseinandersetzungen gingen weiter.
Zwischen Macht und Gewissen
Der folgende Abschnitt des Bandes zeigt, wie wenig Augenhöhe zwischen den Beteiligten herrschte. Die neue Leitung der Schwestern stand zwischen Loyalität zur Kirche und Treue zum Gründer. Gegner Kentenichs in Trier und Rom agierten weiter im Hintergrund, allen voran P. Tromp in Rom und der Pallottiner P. Joseph Friedrich, als Generalassistent der Marienschwestern eingesetzt, der Informationen aus der Gemeinschaft weitergab. Gleichzeitig trat mit P. Augustin Bea SJ, ebenfalls Mitarbeiter im Heiligen Offizium in Rom, ein wichtiger Gegenpol auf: Er setzte sich für die Schwestern und für eine weitergehende Unabhängigkeit Schönstatts ein.
„Im Heiligen Offizium wird die Lage in Schönstatt nicht einheitlich beurteilt“, hält die Redaktion fest – ein bemerkenswerter Satz, der andeutet, wie tief die Spannungen selbst innerhalb der römischen Behörden gingen. Der Band macht sichtbar, dass die Schönstatt-Krise kein einfacher Konflikt zwischen Gehorsam und Ungehorsam war, sondern ein vielschichtiges Ringen um Deutungshoheit, Verantwortung und geistliche Autorität.
Schweigen und Widerspruch
Das Jahr 1955 brachte keine Entspannung. Im Gegenteil: Immer neue Verbote und Anordnungen prägten die Situation. Der Generalobere der Pallottiner, P. Wilhelm Möhler untersagte P. Kentenich „endgültig und absolut“, mit den Marienschwestern oder anderen Gliederungen seiner Bewegung Kontakt zu halten. Der Gründer, der bis dahin geschwiegen hatte, begann nun, seine Sicht offen darzulegen, ein Schritt, der im Rückblick als Wendepunkt gelten kann.
Hier zeigt sich die Tragik dieser Jahre: Während kirchliche Instanzen versuchten, durch Reglementierung Kontrolle auszuüben, begann Kentenich, theologisch und menschlich zu reflektieren, was Schönstatt eigentlich sei. Es ging nicht mehr nur um Gehorsam, sondern um das Selbstverständnis einer geistlichen Bewegung in der modernen Kirche.
Kampf um die Provinzoberinnen – Stellvertretend für die ganze Bewegung
Auch der letzte Abschnitt des Bandes ist weiter von Machtfragen durchzogen. Wieder standen sich zwei Lager gegenüber: Trier, Rom und P. Friedrich auf der einen Seite, die Generalleitung der Schwestern auf der anderen. Die bei der Wahl der Generalleitung vermeintlich „unterlegene“ Seite wollte wenigstens durch die Bestimmung von neuen Provinzoberinnen der Marienschwestern entscheidenden Einfluss behalten. Hinter dieser Auseinandersetzung um Ämter und Befugnisse, so heißt es in der Einführung, gehe es um tiefere Fragen wie: „In welcher Beziehung stehen die Gesellschaft der Pallottiner und die Schönstatt-Bewegung? Geht es hier nur um eine Arbeitsbeziehung im Apostolat oder um eine unlösbare Beziehung von den Wurzeln her? Ist Schönstatt nur eine Ausfaltung der Idee vom Katholischen Apostolat, wie sie von Vinzenz Pallotti vertreten wurde, oder hat das Schönstatt-Werk einen eigenständigen Ursprung?“ Fragen, die das Ringen um Identität und geistliche Eigenständigkeit der Bewegung auf den Punkt bringen.
Die Redaktion deutet diese Phase als exemplarisch: „Was von außen wie eine interne Ordensfrage aussieht, erweist sich bei näherer Betrachtung als eine stellvertretende Auseinandersetzung für die gesamte Schönstatt-Bewegung.“ Die Schwestern standen für das ein, was Kentenich als „organisches Denken“ bezeichnete, ein geistliches Prinzip, das Beziehung, Vertrauen und Freiheit immer in lebendiger Verbindung mit Autorität sieht. Wo dies nicht der Fall ist, entstehen starke Spannungen und Zerreißproben. Damit wurde die Konfliktgeschichte auch zu einer Geschichte der geistlichen Reifung.
Vom Streit zur Selbstreflexion
In der Zusammenschau der bisher veröffentlichten beiden Teilbände der Studienausgabe 4 – von 1951 bis 1955 – zeigt sich, wie aus kirchlicher Konfrontation allmählich eine Reflexion der eigenen Identität entstand. Als entscheidende Fragen kristallisieren sich heraus: Wer ist Pater Kentenich? Nur ein Weiterführer der Idee Vinzenz Pallottis oder ein eigenständiger Gründer? Und: Was ist Schönstatt? Ein Werk der Pallottiner oder eine unabhängige geistliche Bewegung?
Die Quellen belegen, dass diese Fragen nicht am grünen Tisch, sondern unter hohem innerem Druck entstanden. „Man kann den immer stärker werdenden ‚Überdruck‘ als Subtext wahrnehmen“, heißt es in der Einführung. Die Dokumente machen sichtbar, wie aus Gehorsam Konflikt, aus Konflikt Selbstprüfung und schließlich Identität wurde.
Wie dokumentiert wird
Herausgeber Eduardo Aguirre beschreibt die Editionsarbeit als „Werkstatt der Dokumentation“. Jedes Schreiben, jeder Brief, jedes Dekret wird in seinen Bezügen sichtbar gemacht. Viele Funde stammen aus verschiedenen Archiven und wurden erst jetzt zugeordnet. „Umso erfreulicher ist es, wenn auch in diesem Teilband solche zusätzlich gefundenen Dokumente veröffentlicht werden können“, schreibt Aguirre. Das Ergebnis ist ein wissenschaftlich sorgfältiges, zugleich spannendes Geschichtsbuch, eine Art „Kirchenkrimi“ aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, der zeigt, wie geistliche Überzeugung und institutionelle Macht miteinander rangen.
Bibliographische Angaben
- Dokumente zur Geschichte der Schönstatt-Bewegung. Studienausgabe 4: Dekrete und Kontroversen um das Schönstatt-Werk. Dokumente und Hintergründe aus den Jahren der Apostolischen Visitation und der Exilszeit – 1951 bis 1966. Teilband 2: Januar 1954 bis Dezember 1955.
- Herausgeber: Eduardo Aguirre, Redaktion und Einführungen: Hubertus Brantzen, Redaktion, Umschlag, Satz und Layout: Heinrich Brehm.
- 1. Auflage, © 2025 Patris Verlag, 56179 Vallendar-Schönstatt.
- ISBN 978-3-946982-40-1, 600 Seiten, 22 €
- DOWNLOAD: Studienausgabe 4.2 - Inhaltsverzeichnis und Vorwort des Herausgebers