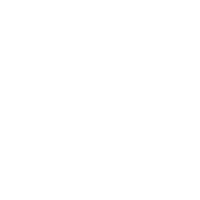Nachrichten
Magdalena Kiess: Die Heimat im Koffer: Über die Kunst der Verwurzelung in bewegten Zeiten

(Foto: Nubla Navarro, Pexels.com)
Kommentar der Woche:
Die Heimat im Koffer: Über die Kunst der Verwurzelung in bewegten Zeiten

Magdalena Kiess, Berlin (Foto: basis-online.net)
Magdalena Kiess
Die Heimat im Koffer: Über die Kunst der Verwurzelung in bewegten Zeiten
13.08.2025
„Ich hab‘ noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin…“. An diesen Schlager von Marlene Dietrich aus den 50er-Jahren (Original von Bully Buhlan) muss ich zurzeit sehr oft denken. Sie singt von jener bittersüßen Sehnsucht nach dem Zuhause, das sie zurückgelassen hat; von den Erinnerungen an die Heimat, geschnürt in einen Koffer.
Ich ziehe bald um und packe in diesen Tagen viele Habseligkeiten in Koffer und Kisten. Und auch ich habe so einen Koffer von „Seligkeiten vergangener Zeiten“. Der steht nicht in Berlin – da stehen meine ganz realen Umzugskartons – sondern ich bewahre ihn innerlich auf, seitdem ich vor ein paar Jahren aus meiner Heimatstadt weggezogen bin.
Viele Menschen verlassen ihre Heimat und schlagen anderswo ihre Zelte auf. Berufliche Träume locken die einen über Kontinente hinweg, die Liebe führt die anderen in fremde Kulturen, und gesellschaftliche Umbrüche zwingen immer wieder zu Entscheidungen zwischen dem Vertrauten und dem Ungewissen.
Das Glück, wie ich jederzeit und sogar relativ schnell in die alte Heimat zurückkehren und den Koffer mit neuen Schätzen bestücken zu können, haben nicht alle. Lebensgefahr durch Krieg, Klimafolgen und Vertreibung zwingen derzeit Millionen Menschen, unfreiwillig und unter schwersten Bedingungen, ihr vertrautes Umfeld verlassen zu müssen.
Alle genannten eint die Lebensaufgabe, an einem anderen Ort Heimat zu finden.
Das ist nicht leicht.
Die Wissenschaft bestätigt, was viele täglich erleben: Die Sehnsucht nach Heimat oder den geliebten Menschen in der Ferne kann sich zu mehr auswachsen als bloßem Heimweh. Entwurzelung führt zu wesentlich höheren Depressionsraten und kann zu funktionalen Beeinträchtigungen führen – selbst bei Menschen, die freiwillig ihre Heimat verlassen haben.
Heimat ist dabei weit mehr als ein geografischer Ort. Sie kann ebenso gespeist werden aus Tradition, Sprache oder Kultur. Ebenso hat Heimat eine soziale Dimension und baut auf Beziehungen auf.
Pater Josef Kentenich entwickelte bereits in den 1930er Jahren eine systematische Antwort auf die Krise der Heimatlosigkeit seiner Zeit, geprägt durch Not, Krieg und Vertreibung(1). Seine Diagnose war schonungslos: „Das Heimatproblem dürfte in der Weite, wie wir es verstanden wissen wollen und darstellen dürfen, letzten Endes das Kulturproblem der heutigen Zeit sein. Deswegen ist Heimatlosigkeit das Kernstück der heutigen Kulturkrise“(2). Auf seiner Gegenwartsbeobachtung aufbauend, entwarf er ein viergliedriges Heimatkonzept:
Das physische Element umfasst reale Gegebenheiten – Orte, Gegenstände, Personen. Das psychisch-gemüthafte Element beschreibt die emotionale Bindung daran durch bewusste Erinnerungsarbeit. Das geistige Element meint jenen Kreis von Idealen und Werten, in dem wir geistige Heimat finden. Das übernatürliche Element schließlich bezeichnet die letzte Geborgenheit in Gott.
Eine nachvollziehbare Gliederung: Die realen Gegebenheiten sollen die psychische und letztlich die religiöse Heimat ausdrücken und sichern. Beheimatung kann dadurch eine mobile, weil auch psychisch-spirituelle Dimension bekommen. Möglich wird das bei Kentenich insbesondere durch Bindungen: „Je mehr ein Mensch sich aus eigener Entscheidung an Orte, Personenkreise, Gedankenwelten und über sie letztlich an Gott selbst bindet, desto mehr erfährt er seine eigentliche, unverlierbare Heimat.“(3)
Praktisch können das etwa das Einrichten der neuen Wohnung mit persönlichen Gegenständen sein, die bewusste Pflege von Freundschaften, das soziale Engagement im Verein und schließlich die spirituelle Verwurzelung durch regelmäßige geistliche Übungen wie Gebet oder Meditation sein.
Die Sehnsucht nach Beheimatung ist also der Versuch, sich seine Umwelt vertraut zu machen und sich innerhalb dieser neuen Umgebung als sicher, sinnhaft und eingebunden zu erleben. Heimat wäre dann der Raum, in dem das eigene Leben möglich wird und man sich selbst in Bezug auf Andere realisieren kann – und weniger ein Herkunftsnachweis oder die Erinnerung an „Seligkeiten vergangener Zeiten“.
Wer heute – freiwillig – seinen Koffer packt, muss nicht nur Erinnerungen mitnehmen, sondern kann bewusst die Werkzeuge der Beheimatung einpacken: die Bereitschaft zu Bindung, die Offenheit für Gemeinschaft, den Mut zur aktiven Lebensgestaltung. Dann bleibt der Koffer auch nicht Symbol für die „vergangenen Zeiten“, sondern wird zum Versprechen eines Neuanfangs. In ihm tragen wir das portable Fundament für jene Heimat, die unabhängig vom Ort entstehen kann: „Wo wir Geborgenheit finden und geben, da ist Heimat.“
Magdalena Kiess, Berlin
Theologin
(1) Vgl. hierzu und im Folgenden: Faatz, Martin, Heimat, in: https://www.j-k-i.de/lexikon/heimat/;
zuletzt aufgerufen am 13.08.25, 13:05 Uhr.
(2) Ebd.
(3) Ebd.