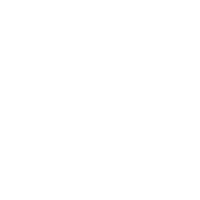Nachrichten
Schönstatt politisch – den Sinn der Weltgeschichte verstehen

Prof. Dr. Joachim Söder beim Online-Vortrag des JKI zum Thema „Zur Sache: Schönstatt – politisch?“ (Foto: Brehm)
Cbre/Hbre. Unter der Überschrift „Zur Sache: Schönstatt – politisch?“ hat am 16. März ein dreiteiliges Online-Seminar des Josef-Kentenich-Institutes (JKI) begonnen. Professor Dr. Joachim Söder, Aachen, Präsident des JKI, konfrontierte die über 60 Teilnehmenden in seinem etwa einstündigen Online-Vortrag mit Gedanken zu einer „politischen“ Dimension der Spiritualität Schönstatts, die dem Schönstatt-Gründer Pater Josef Kentenich ein Anliegen gewesen sei und die sich u.a. am Werden verschiedener Schönstatt-Heiligtümer festmachen ließe. Der hochinteressante Vortrag nahm die Zuhörenden in eine bisher wenig bekannte Färbung schönstättischer Spiritualität hinein.
Für eine „Politik des Vaterunsers“
Söder stellte seine Überlegungen in den Zusammenhang der These Pater Kentenichs, dass sich in der politischen Weltlage der Kampf des Guten gegen das Böse, der Streit göttlicher und widergöttlicher Mächte abzeichne, aktuell mit handelnden Akteuren wie Präsident Trump in Amerika, dem Diktator Putin in Russland, Auswirkungen wie dem Ukrainekrieg, dem Zollkrieg Trumps mit Kanada, Mexiko, China und jetzt auch mit Europa. Dass Deutschland einerseits politisch zwischen extremen Lagern tief zerrissen sei und in dieser Lage keine handlungsfähige Regierung habe, sei nicht hilfreich.
Pater Kentenich habe am eigenen Leib erfahren, zu welcher Katastrophe die Machtansprüche eines totalitären Regimes geführt hätten. Daher sei er aus dem Konzentrationslager Dachau mit einer besonderen Wachheit für die weltpolitische Konstellation nach dem Kriegsende 1945 zurückgekommen. Einerseits sah er die Ideologie des Kommunismus als unvereinbar mit christlicher Weltverantwortung, andererseits habe er auch in der Option des sich in der westlichen Welt entwickelnden schrankenlosen Liberalismus keinen zukunftsfähigen Weg gesehen.
Politik der Selbstherrlichkeit und der Selbstvergottung
In der „Epistola perlonga“, dem Schreiben, das Auslöser für die kirchliche Visitation Schönstatts durch die vatikanische Behörde des Heiligen Offiziums war, habe Pater Kentenich bereits 1949 davon gesprochen, dass den abendländischen Völkern das Organ für die „Politik des Vaterunsers“ verloren gegangen sei. An diese Stelle sei die „Politik der Selbstherrlichkeit und der Selbstvergottung“ getreten, die man, so Söder, auch heute wieder beobachten könne. Kentenichs Diagnose, dass „die Völker nicht mehr geöffnet (sind) für das, was von oben kommt: für Gott und Göttliches, sondern nur für das, was von unten kommt, vom Triebleben, vom Teufel, vom Weltgeist. Den Himmel über sich haben sie weggewischt und die Hölle unter sich geöffnet …“ (Epistola perlonga, S. 493), bewahrheite sich auch in den heutigen weltpolitischen Geschehnissen.
Pater Kentenich sei nach der Rückkehr aus Dachau klar gewesen, dass der Krieg zwar zu einem Ende gekommen sei, dass aber die Kräfte, die miteinander gerungen hätten, weiterhin existierten. Daher habe er z. B. mit der ihm eigenen Weitsicht die Ostprovinz der Marienschwestern in Friedrichroda, im Ostteil Deutschlands verselbständigt, falls die Schwestern möglicherweise in keinen Kontakt mehr mit Schönstatt treten könnten, was ja ab 1948 durch das Entstehen der BRD und der DDR und dem dazwischen liegenden Eisernen Vorhang sogleich eingetroffen sei.

Drei Schönstatt-Heiligtümer sind Gegenstand der Online-Vortragsreihe des JKI (Foto: Brehm)
Wie sehr Pater Kentenich diese politischen Überlegungen und ihre Konsequenzen umgetrieben hätten, und wie das auch Resonanz in der Schönstattfamilie gefunden habe, könne man am geschichtlichen Werden einiger Heiligtümer in Deutschland nachvollziehen. Darauf wolle die Online-Reihe einen Blick werfen: im August auf das sogenannte „Diplomaten-Heiligtum auf dem Bonner Kreuzberg, im November auf das Schönstatt-Heiligtum in Friedrichroda und an diesem Abend mit dem Fokus auf das 1950 als erstes Filialheiligtum auf europäischem Boden in Maria Rast, in der Nordeifel, eingeweihte Schönstatt-Heiligtum.

1950 wird das Schönstatt-Heiligtum in Maria Rast, Euskirchen, eingeweiht (Foto: Brehm)
Das Ringen der göttlichen mit der widergöttlichen Dynamik
Nachdem die Schönstätter-Marienschwestern 1948 die Villa des industriellen Kleinadeligen Max von Mallincrodt erworben und zum Provinzhaus umgebaut hätten, hätten sie dort 1950 auch das erste Filialheiligtum auf deutschem Boden errichtet, so führte Prof. Söder weiter aus. Am 2. Juli 1950, wenige Tage nach Beginn des Koreakrieges, der die Welt an den Rand des 3. Weltkrieges gebracht habe, sei diese Schönstatt-Kapelle von Pater Kentenich eingeweiht worden. Seine Ansprache anlässlich der Einweihung habe Kentenich nicht etwa mit den Worten „meine liebe Schönstattfamilie“ begonnen, sondern mit den Worten „mein liebes katholisches Volk“. Schon damit sei deutlich geworden, dass es Pater Kentenich zum damaligen Zeitpunkt um viel mehr als um die Binnenperspektive für Schönstatt gegangen sei. Kentenich habe beschrieben, dass die ganze Welt in Aufruhr sei, dass die Sorge um einen neuen Weltbrand umgehe und dass Deutschland und Europa ein luftleerer Raum geworden seien, ohne christliche Fundamente. Für den Schönstatt-Gründer sei es ganz klar gewesen, dass sich in dieser weltpolitischen Lage das Ringen der göttlichen Dynamik mit der widergöttlichen Dynamik zeige.
In der eigenen Seele das Widergöttliche überwinden
In diesem Horizont habe Pater Kentenich damals das Schönstatt-Heiligtum in Maria Rast gesehen. Die Gottesmutter möge von hier aus das ganze „Volk widerstandsfähig machen gegen den Unglauben“, so zitierte Söder Pater Kentenich. In Maria Rast habe sich Pater Kentenich überzeugt gezeigt, dass es Ziel des Christen sei, den wahren Frieden zu finden durch die Überwindung der widergöttlichen Kräfte in der Weltgeschichte. Pater Kentenich mache deutlich, dass dazu jede und jeder zuerst in die eigene Seele schauen und dort das Widergöttliche überwinden müsse. Hier bringe Pater Kentenich Maria als Friedenskönigin ins Spiel, die in der Geheimen Offenbarung inmitten der widergöttlichen Kräfte als Schlangenzertreterin dargestellt werde. Daher, so Joachim Söder, sei es nicht überraschend, dass heute im Park von Maria Rast eine unübersehbare Statue der Schlangenzertreterin zu finden sei.

Eine Statue Maria als Schlangenzertreterin steht auf dem Gelände des Schönstatt-Zentrums Maria Rast (Foto: Brehm)
Liebesbündnis – keine Spiritualität für Einsiedlerinnen und Einsiedler
An diesem ganzen Vorgang werde deutlich, wie „Schönstatt politisch“ verstanden werden könne. Zunächst sei es spezifisch schönstättisch, Maria primär als Erzieherin zu erleben, so Söder. Sie erziehe Menschen zu Werkzeugen in der Hand Gottes. „Schönstätter sagen Ja zur Selbsterziehung an der Hand der Gottesmutter mit dem Ziel aktiv zu werden“, so der Referent, „nicht nur als persönliche Frömmigkeitsübung im abgeschlossenen Kämmerlein, sondern das Ziel der Selbstheiligung ist das Eingreifen in die Geschehnisse der Welt.“ Das Liebesbündnis, so Söder weiter, „ist nicht eine Spiritualität für Einsiedlerinnen und Einsiedler, sondern für Menschen, die hinausgehen und die Welt im Sinne Gottes verändern, weil sie sich als Werkzeug selbst Gott zur Verfügung stellen. Also etwas ganz aktives.“
Das Heiligtum in Maria Rast und seine welthistorische Bedeutung
Bei einem weiteren Besuch in Maria Rast am 20. August 1950 habe Pater Kentenich ausgeführt, dass sich die Gottesmutter vom Schönstatt-Heiligtum in Maria Rast aus darum bemühe, „dass unser Glaubensgeist wächst, dass auch wir Sinn bekommen für die übernatürliche Wirklichkeit, also für das, was hinter der Weltgeschichte an Dynamik, an Kampf, an Konflikt steht“, so Söder. Wer dafür einen Sinn entwickle, könne nicht unbeteiligt bleiben, sondern sei herausgefordert sich auf eine der beiden Seiten zu stellen. Wenn Maria im Schönstatt-Heiligtum von Maria Rast als Friedenskönigin angerufen werde, dann gehe es nicht darum, dass Maria irgendwie in der Welt Frieden schaffen möge. Maria werde dort im Heiligtum angerufen „als unsere Erzieherin, damit wir für den Frieden in der Welt sorgen.“ Und wenn Pater Kentenich sage: „Die Welt, die nach dem Frieden schreit, muss nach der großen Erzieherin der Völker, muss nach der Friedenskönigin schreien“, dann meine er das im Sinne dieser aktiven Einstellung: „Gottesmutter, hier bin ich, ich stelle mich dir zur Verfügung damit du durch mich hindurch Frieden wirken kannst.“ Das, so Joachim Söder, sei die politische Dimension Schönstatts, das sei „die Politik des Vaterunsers von Maria Rast aus“. In diesem Sinne habe die Einweihung des Heiligtums in Maria Rast eine welthistorische Bedeutung.

Austauschrunde per ZOOM (Foto: Brehm)
Liebesbündnis hat geistliche, apostolische und politische Dimension
In der abschließenden Austauschrunde wurde unterstrichen, dass der Einsatz im Liebesbündnis mehrere Dimensionen habe: Geistlich durch persönliche Beiträge, die Maria für andere zur Verfügung gestellt werden. Apostolisch durch das Ansprechen und Begeistern von Menschen für den Weg des Liebesbündnisses. Und politisch, indem sich alle fragen, „was kann ich wo tun, damit die derzeitigen Verhältnisse sich mehr in Richtung Gottesreich entwickeln“. Diese politische Dimension verbunden mit der Selbsterziehung, so Söder abschließend, könne aus dem Klein-Klein des Alltagsstrebens herausreißen und neue Kraft geben, sich gesellschaftsfördernd einzubringen.
Leserbeitrag
20.03.2025, 09:06 Uhr
Vielen Dank für den Vortrag an Joachim Söder für die Herausstellung der Bedeutung Marias in der Heilsgeschichte. Erwähnenswert ist, dass die Flagge Europas blau mit 12 Sternen auf die Anregung der drei großen katholischen Europäer, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi und Robert Schuman ausgewählt worden ist: Blau als Farbe Mariens und die 12 Sterne der apokalyptischen Frau, die dem Widerpart Gottes das Haupt zertritt. Kommentar der drei. Einem Satan, dem Nationalsozialismus hat sie schon das Haupt zertreten, dem sowjetischen Kommunismus wird sie ihn noch zertreten. Das ist mittlerweile geschehen, aber dem Drachen sind gerade in der Gegenwart weitere Köpfe nachgewachsen und die apokalyptische Frau wird noch einmal herausgefordert. Die Heilsgeschichte geht weiter.
Helmut Müller Vallendar