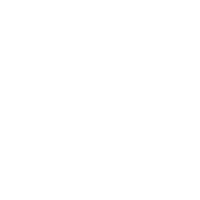Nachrichten
Schönstatt – politisch? Eine wenig beachtete Dimension der Schönstatt-Spiritualität

Zur Sache: Schönstatt - politisch? JKI-Online-Seminare (Foto: JKI)
Hbre. „Schönstatt – politisch?“ ist das Thema der dreiteiligen Online-Seminarreihe, die das Josef-Kentenich-Institut im Jahr 2025 anbietet. An drei Abenden im März, August und November sind alle Interessierten eingeladen, sich – ausgehend von einem Blick auf die Schönstatt-Heiligtümer in Maria Rast, auf dem Bonner Kreuzberg und in Friedrichroda – mit Aspekten der Fragestellung auseinander zu setzen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Zugangsdaten zum Zoom-Meeting werden den angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechtzeitig vor der jeweiligen Veranstaltung zugemailt.
Kentenich: Kommunismus und schrankenloser Liberalismus mit christlicher Weltverantwortung unvereinbar
Nachdem P. Kentenich die in die Katastrophe führenden Machtansprüche eines totalitären Regimes im Konzentrationslager selbst erfahren hatte, war er besonders wach für die weltpolitische Konstellation nach 1945. Sowohl in der Ideologie des Kommunismus als auch im schrankenlosen Liberalismus der westlichen Welt sah er politische Optionen, die mit christlicher Weltverantwortung unvereinbar waren. So schreibt er 1949, dass heute „das Organ für die Politik des ‚Vater unser‘ verlorengegangen“ sei (Epistola perlonga, S. 493).

Zur Sache: Schönstatt - politisch? JKI-Online-Seminare, Plakat (Foto: JKI)
Ein Heiligtum wird Zentrum katholischen Lebens im sozialistischen Staat
Schon im Oktober 1945 macht P. Kentenich die in der sowjetischen Besatzungszone liegende Ostprovinz der Marienschwestern weitgehend unabhängig von der schönstättischen Zentrale, um sie auch dann lebensfähig zu erhalten, wenn direkte Beziehungen in den Westen, nach Schönstatt, unmöglich würden. Im Zuge dieser Verselbständigung regt er 1950, kurz nach Gründung der DDR, die Errichtung eines Heiligtums in Friedrichroda an. 1954 wird dieses Heiligtum eingeweiht und entwickelt sich zum Zentrum katholischen Lebens im sozialistischen Staat. Von dort werden 1992 Marienschwestern nach Kaliningrad (Russische Föderation) entsandt; die Niederlassung besteht noch heute.
Ein Heiligtum für den neuen Menschen und die Gestaltung der Welt
Mit der Gründung von Filialheiligtümern will P. Kentenich auch einen Beitrag zur Sensibilisierung für die politische Botschaft des Christentums leisten. So stellt er 1950 die Errichtung des ersten Filialheiligtums auf europäischem Boden (Maria Rast / Euskirchen) ausdrücklich in den Zusammenhang mit dem damals tobenden Korea-Krieg, in dem sich Ost und West, Kommunismus und Kapitalismus gegenüberstehen. Im Festvortrag fordert er dazu auf, „den Sinn der Weltgeschichte zu verstehen“: als ein Ringen zwischen göttlichen und widergöttlichen Dynamiken. In Maria Rast soll die Gottesmutter als Friedenskönigin an der Formung eines ‚neuen Menschen‘, der Verantwortung für die Gestaltung der Welt übernimmt, mitwirken.
Das „Diplomatenheiligtum“ für Impuls für christliche Politik
Nachdem die Franziskaner angekündigt hatten, 1968 die alte Bonner Wallfahrtsstätte Kreuzberg aufzugeben, besprach Bischof Heinrich Tenhumberg mit P. Kentenich, ob dort, am Sitz der Bundesregierung, nicht ein Schönstattzentrum etabliert werden sollte. P. Kentenich empfahl am 14. September 1968, einen Tag vor seinem Tod, die Übernahme des Wallfahrtsortes und die Gründung eines Bildungshauses für christliche Kultur. Vom Bonner Kreuzberg mit seiner jahrhundertealten Tradition sollte ein Impuls für christliche Politik ausgehen, und die Schönstätter sollten sich für diese Sendung verantwortlich halten. Ein Heiligtum wurde errichtet, für das sich der Name „Diplomatenheiligtum“ einbürgerte, weil Schönstätter, die als Diplomaten ihrer Heimatländer in Bonn akkreditiert waren, dort gern zusammenkamen. Seit 1980 wirken die Marienbrüder auf dem Kreuzberg und unterhalten dort das ‚Zentrum für internationale Bildung und Kulturaustausch‘ zusammen mit einem Spracheninstitut.
Mehr Informationen
- DOWNLOAD: Flyer (pdf)
- ANMELDUNG an: sekretariat@j-k-i.de, bis jeweils drei Tage vor der Veranstaltung (d.h. bis Donnerstagabend)