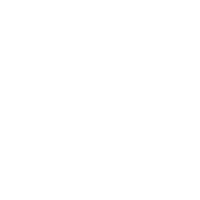Nachrichten
Sprachlosigkeit und Gebet miteinander teilen

Jahresbitte 2020/2021 der Schönstatt-Bewegung in Deutschland (Foto: pixabay)
Liebe Mitglieder und Freunde der Schönstatt–Bewegung,
liebe Leserinnen und Leser von www.schoenstatt.de,
Die Leitartikel des Bündnisbriefes gehen immer einen Monat vor dem entsprechenden Bündnistag, für den sie dann bestimmt sind, in den Druck. So kam es, dass meine Betrachtung im August die Dankbarkeit für die Urlaubszeit im Blick hatte. Im August war unsere Stimmung jedoch ganz anders. Unser ganzes Land erlebte die Nachrichten und die Bilder von den schrecklichen Überschwemmungen. Seit über einem Jahr erleben wir das Leben bereits als einen gewissen Ausnahmezustand. Die Herausforderungen der Coronapandemie sind noch nicht überwunden.
Unser Leben hat sich in diesen Monaten auf das Zuhause orientiert. Homeoffice und Homeschooling wurden für viele zur beruflichen und schulischen Selbstverständlichkeit. Und auch Gottesdienste wurden zu Hause gestaltet oder von dort online mitgefeiert. Im „Zuhause“ verdichtet sich das ganze Leben. Das ist sicher auch eine Herausforderung. Vor allem aber haben wir unser Zuhause als Rückzugsort erlebt. Die außergewöhnlich heftigen Regenfälle haben sogar diesen Rückzugsort zerstört.
Ganze Häuser schwimmen weg und brechen zusammen
So verheerende Zerstörungen mit vielen Todesopfern konnten wir uns in unserem Land nicht vorstellen. Nicht nur die Bilder sind uns plötzlich nähergekommen. Verwandte und Bekannte sind vielleicht nicht unmittelbar betroffen, aber leben ganz in der Nähe der Überschwemmungsorte. Gymnich, der Geburtsort unseres Gründers, ist nur ein paar Kilometer entfernt.
Inzwischen ist eine große und vielfältige Hilfsbereitschaft wach geworden. Kurzfristige Hilfen müssen organisiert und neue Zukunftsperspektiven entwickelt werden. Und dazwischen müssen die einzelnen menschlichen Schicksale und Erschütterungen begleitet werden. Unmittelbar Betroffene müssen mit der Trauer um Verstorbene und mit Ungewissheiten und Verzweiflung zurechtkommen. Und auch wir alle spüren in uns Fragen. Wie gehen wir mit solchen Erschütterungen um? Viele unserer Gottesdienste haben wir bewusster als in anderen Jahren mit dem Wettersegen beendet. „Gott, der allmächtige Vater, segne euch und schenke euch gedeihliches Wetter; er halte Blitz, Hagel und jedes Unheil von euch fern“, heißt es in dem Text dieses kirchlichen Ritus. Abhängigkeit von Wind und Wetter und Bedrohungen durch die Kräfte der Natur gehörten früher viel mehr zum alltäglichen und selbstverständlichen Bewusstsein und Lebensgefühl der Menschen. Bitten und Gebete, in denen sich die Menschen mit ihren unterschiedlichsten Nöten an Gott wenden und von ihm Hilfe erhoffen, waren da ähnlich naheliegend und spontan. So naheliegend und spontan ist uns heutigen Menschen das nicht mehr. Unsere moderne Gesellschaft bietet uns mit vielen Vorsorgemöglichkeiten, dem technisch Machbaren, der wirtschaftlichen Stabilität und funktionierenden Sozialversicherungen ein Grundgefühl von Sicherheit. Manchmal habe ich den Eindruck, dass auch in einer modernen Spiritualität es gar nicht so leicht gelingt, dass aus Not und Schicksalsschlägen vertrauensvolles „Bitten und Flehen“ entsteht. Im Brief an die Philipper beschreibt Paulus das als andauernde Form, wie sich unser Glaube im Gebet ausdrückt: „Bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott! Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren“ (Phil 4,5-7). Paulus weiß, dass in jeder Not Fragen und Zweifel wach werden. Glaube an Gott in Erschütterungen, vertrauensvolles Bitten, wo sich kein Ausweg zeigt, braucht einen „Frieden Gottes, der alles übersteigt“. Paulus weiß, dass es eine Nähe zu Jesus gibt, die auch die unbeantworteten Fragen und die Hilflosigkeit in Not und Leid übersteigt.
Sprachlosigkeit und Gebet miteinander teilen
Notfallseelsorgerinnen und -seelsorger machen die Erfahrung, dass mehr als ausdrückliches seelsorgliches Reden und rituelles Tun vor allem die Anwesenheit eine entscheidende Rolle spielt und in schweren Krisensituationen hilfreich ist. Je weniger eine geprägte Sprache und Kultur von religiösen Ausdrucksmöglichkeiten vorhanden ist, umso mehr braucht es das sensible Mitgehen mit dem Schmerz und den Fragen, die keine Worte finden. Still bleiben können, wenn etwas nicht oder noch nicht ausgesprochen werden kann, schafft Nähe. In dem sogenannten „Notgebet“ (s. S. 12) aus der Sammlung der Dachau-Gebete vertraut Pater Kentenich auf die stille Nähe Marias und formuliert: „Wie dein Sohn, als er noch auf der Erde weilte, Hunger stillte, Kranke tröstete und heilte, so geh mit ihm segnend still durch unsere Reihen …“.
Sensibilität für die jeweils richtige Gebets- und Ausdrucksform ist nicht nur für die Menschen wichtig, denen wir in Notsituationen begegnen. Sie ist auch für uns selbst wichtig, und wir sollten wach sein, was für uns selbst passend und echt ist. Ich glaube, viele Menschen zünden deshalb gerne eine Opferkerze an, weil man in diesem Vorgang auch das Unausgesprochene zu einem Gebet machen kann. Das gilt auch für das gemeinsame oder persönliche Wiederholen der Worte der Verkündigungsstunde „Gegrüßet seist du, Maria …“ beim Beten des Rosenkranzes. Auch der Bilderreichtum der Psalmen bietet Platz, das eigene Erleben in dieser symbolischen Sprache wiederzufinden. Gerade wenn Beten tiefer ins Herz geht, ist es wichtig, einen Ausdruck zu finden, auch wenn Worte fehlen. Paulus kennt diese Schwierigkeit und verweist auf den Heiligen Geist und sein Wirken in uns: „Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt“ (Röm 8,26).
Pater Kentenich hat beim Beten für sich auch so eine symbolische, indirekte Ausdrucksform gefunden. Er sagt, dass er oft für sich oder für andere Person besonders gerne Bezug genommen hat zur Situation der Hochzeit zu Kana und wie Maria die Notsituation Jesus anvertraut: „Sie haben keinen Wein mehr!“ In diesem symbolischen Wort können sich ganz unterschiedliche Erfahrungen von Mangel und Verlust bündeln. Auch dieses Motiv findet sich in dem Notgebet: „Sage deinem Sohn wie einst in Erdenzeiten, als er half in Nöten und Verlegenheiten: Herr, sie haben keinen Wein und keine Speisen. Dann wird sicher er Erhörung uns erweisen.“
Auch im Johannes-Evangelium geht es in dem Kapitel von der Hochzeit zu Kana bereits um mehr, als um den konkreten Engpass bei einem Festessen. Das Wunder der Wandlung von Wasser in Wein – Johannes nennt es extra das erste Zeichen Jesu – verweist auf die eigentliche Stunde im Leben Jesu. Das erste Zeichen wird zum Beginn des Glaubens der Jünger. In diesem ersten Zeichen geht es um die Stunde, die alles Leid und alle Not der Geschichte verändert. Es geht um die Stunde des Kreuzes Jesu. Es geht um seine Hingabe an Gott aus Liebe zu uns Menschen, die den Tod und das Sterben verwandelt hat. Es geht um die Stunde, die das menschliche Ende des Lebens zum Tor hinein in die Vollendung in Gott gemacht hat. In dem einfachen Wort „Sie haben keinen Wein mehr“, wo so vieles unausgesprochen bleibt, entsteht eine Beziehung zu dem, der als „Gott von Gott und Licht vom Licht“ auch die dunkelsten menschlichen Stunden heller machen kann.
Ich wünsche uns allen, dass wir miteinander und füreinander in unserem Beten und Glauben die Worte finden, die uns den Weg zu einem tieferen Vertrauen öffnen.
P. Ludwig Güthlein
Schönstatt-Bewegung Deutschland