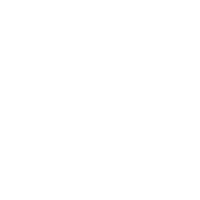Nachrichten
„Zeichen der Zeit: Das Ende der Volkskirche – erleiden oder gestalten? Synodale Prozesse, Perspektivwechsel, Wagnisse“
„Zeichen der Zeit: Das Ende der Volkskirche – erleiden oder gestalten?
Synodale Prozesse, Perspektivwechsel, Wagnisse“
Dr. Daniela Mohr-Braun
DOWNLOAD: PDF-Version
17. März 2017
Ich danke Ihnen, dass ich heute hier sprechen darf. Der Blickwinkel, den ich in Ihre Tagung eintragen möchte, ergibt sich aus meiner derzeitigen Tätigkeit als Theologische Referentin im sogenannten Synodenbüro des hiesigen Bistums Trier.
Synodale Wege
Wie Sie vielleicht wissen, hat das Bistum Trier in den Jahren 2013 bis 2016 eine Diözesansynode durchgeführt. Im Verlauf von 7 Vollversammlungen haben 280 Synodale zweieinhalb Jahre lang beraten. Geleitet waren sie von der Frage, die Bischof Dr. Stephan Ackermann zum Auftakt folgendermaßen formuliert hatte: „Wie wollen wir persönlich und gemeinsam unseren Weg des Glaubens im Bistum Trier gehen in den sich rasant ändernden Rahmenbedingungen des 3. Jahrtausends?“ (Predigt zur Ankündigung der Synode, in: Bischofsworte 1, Trier 2014, 15.)
Für diese Fragen, wie wir in unserer Zeit Christen sein und Kirche gestalten können, erbat sich der Bischof Beratung durch die Synodalen. Von ihnen waren 61 % Männer und 39 % Frauen, 42 % Kleriker und 58 % Laien. In den 7 Vollversammlungen (je 2-4 Tage) und zahllosen Sitzungen von Sachkommissionen sowie in begleitenden Workshops wurden zentrale Themen unseres Glaubens und des kirchlichen Lebens beraten. Am 1. Mai 2016 gingen diese Beratungen zu Ende mit der Abstimmung über das Abschlussdokument der Synode, das anschließend von Bischof Ackermann unterzeichnet und zur Umsetzung übergegeben wurde.
Inzwischen ist das Bistum Trier in der „nachsynodalen Phase“ angekommen. Ich darf mitarbeiten in der Stabsstelle zur Umsetzung der Synode im Bistum Trier. Dieser Weg ist ein äußerst spannender. In der Zeit der Synode selbst waren es zunächst vor allem diese 280 Menschen – gelegentlich unter Zuhilfenahme externer Berater und Beraterinnen –, die sich verständigen mussten. Jetzt in der Zeit danach geht es darum, bis in die kleinste gemeindliche Einheit hinein mit Leben zu füllen, was beraten und entschieden wurde. Es gilt, einen „Riesen“ in Bewegung zu setzen.
Ohne Zweifel ist das Bistum Trier mit seinen 1,4 Millionen Katholiken ein solcher Riese. Und dieser Riese ist ja nach der Synode nicht einfach eine friedliche Menschenansammlung im herrschaftsfreien Diskurs, die alle Probleme gelöst hätte. Sondern es gibt – wie überall in der Kirche – reguläre Zuständigkeiten, Interessenkonflikte, ungelöste Fragen im Hinblick auf die richtigen Geschwindigkeiten der kirchlichen Erneuerung usw. Nicht zuletzt gibt es die verschiedenen Temperamente der Menschen, die hier gemeinsam unterwegs sind … Sie können sich das vorstellen aus dem Blickwinkel der sehr pluralen Schönstatt-Bewegung heraus.
Auch wenn mit großer Einmütigkeit ein Abschlussdokument verabschiedet werden konnte, heißt das noch lange nicht, dass wir uns nach der Synode über alle Schritte der Umsetzung ins Konkrete hinein einig wären. Nein, wir streiten weiter, wir ringen und suchen. Wir sprechen miteinander – manchmal auch nebeneinander oder gegeneinander. Wir suchen nach guten Lösungen und Kompromissen. Möglichst viele Menschen und Gruppen sollen mitgehen können. Niemand soll abgehängt werden, möglichst viele Menschen sollen und wollen eingebunden werden.
Warum erzähle ich Ihnen das alles? Die meisten von Ihnen gehören ja nicht zum Bistum Trier ...
Was hier in Trier geschieht, ereignet sich ja nicht isoliert. Es ist Teil einer großen Umbruchsbewegung, in der sich die katholische Kirche in Deutschland befindet. Hier in Trier wurde das Projekt, gemeinsam Kirche zu sein und auf Zukunft hin zu gestalten, auf dem Weg einer Diözesansynode angegangen. Andere Bistümer wählen andere, ebenso wirkungsvolle Wege der Beratung und dialogischen Wegsuche. Sie alle sind auch getragen vom Impuls des Dialogprozesses der katholischen Kirche in Deutschland, den Erzbischof Dr. Robert Zollitsch im Jahr 2010 angestoßen hatte. Wie können wir heute und in Zukunft Kirche sein? Was bedeuten die derzeitigen Umbrüche für uns? Und in Ihre heutige Runde hineingesprochen: Was bedeuten die derzeitigen Umbrüche für Sie als Mitglieder und Multiplikatoren einer großen geistlichen Bewegung?
Die Schönstatt-Bewegung ist ja wie alle geistlichen Bewegungen innerhalb der Kirche keine Insel der Seligen. Was die gesamte Kirche trifft, das trifft auch Sie. Wir können das z. B. ablesen an den demographischen Zahlen der Entwicklung der Schönstatt-Bewegung in Deutschland. Wir können es ablesen an den Zahlen der Eintritte in die Kerngemeinschaften der Bewegung und an den Austrittszahlen aus eben diesen Gemeinschaften hier in unserem Land. Wir können es ablesen an den ungelösten wirtschaftlichen und inhaltlichen Fragen in so manchem Schönstatt-Zentrum und Gliederungshaus. Hier ist keine Insel der Seligen.
Trotzdem haben die Menschen der geistlichen Bewegungen Vieles, das sie gerade in der derzeitigen Kirchensituation einbringen können. Dies würde ich zumindest unterstellen. Was haben Sie? Oder anders herum formuliert: Was braucht die Kirche von Ihnen, von uns – den Menschen in den geistlichen Gemeinschaften und kirchlichen Bewegungen – gerade in dieser Zeit?
1. Das Ende der Volkskirche – erleiden oder gestalten?
Um diese Frage anzugehen, möchte ich noch einmal kurz auf Bischof Stephan zurückkommen. Mit seiner Frage zum Auftakt der Diözesansynode verband sich für den Trierer Bischof eine Beobachtung, die sich mit dem Stichwort vom „Ende der Volkskirche“ umreißen lässt: dass nämlich, so sieht es Bischof Stephan, das Ende der volkskirchlichen Strukturen, wie wir sie gewohnt waren und lieben gelernt haben, gekommen ist.
Man könnte sagen: Der Patient Volkskirche krankt erheblich und er wird sterben. Damit stirbt nicht die Kirche als ganze, aber doch eine sehr vertraute und liebgewordene Sozialisationsform von Kirche in unserem kulturellen Raum. Bestimmte Engagements werden sterben oder sind schon gestorben, manche Gottesdienstform, das ein oder andere kirchliche Angebot in seiner bisherigen flächendeckenden Form.
Wir können, so die Botschaft von Bischof Stephan an sein Bistum, dieses Sterben nicht abwenden, aber wir können uns entscheiden, es zu gestalten.
Wir können uns entscheiden, diesen Weg von der Volkskirche zur Kirche des Volkes zu gehen,
den Weg von einer sehr versorgten, selbstzufriedenen Kirche, gelegentlich auch von einer sehr auf Kleriker zentrierten und auf hauptamtliche Dienste zentrierten Kirche
hin zu einer Kirche, die lebt von der persönlichen Identifikation und vom Engagement jedes und jeder einzelnen Getauften.
Und wir können uns entscheiden, diesen Weg zu gehen mit Hoffnung und mit Vertrauen. Wir können uns entscheiden, der Kraft des Auferstandenen mehr zuzutrauen als den derzeitigen Anzeichen eines Sterbens.
Hier kommen nun die geistlichen Bewegungen ins Spiel. Hier kommen wir ins Spiel als Menschen, die aus einem Charisma heraus ihr Christsein gestalten und innerhalb der Kirche eine existenzielle Heimat gefunden haben. Was braucht die Kirche von uns? Was können wir geben in dieser Zeit?
a. Identifikation statt Aktionismus
Die Lage der Kirche in Deutschland, wenn wir sie ausgehend von der Bestandsaufnahme der Trierer Synode oder von den statistischen Zahlen her anschauen, die uns die Deutsche Bischofskonferenz für das Jahr 2015 z. B. im Hinblick auf die Zahl der Priesterweihen in der gesamten Bundesrepublik vorgelegt hat, könnte uns ja zu einem maximalen Aktionismus verleiten.
Aber ich meine, zunächst ist das Gegenteil angesagt. Die Trierer Synode hat dieses Gegenteil umrissen mit der Formulierung eines Perspektivwechsels. Dieser lautet: „Charismen vor Aufgaben in den Blick nehmen.“
Es geht eben nicht in erster Linie darum zu fragen: „Was sollen wir tun?“ – oder gar: „Was müssen wir tun?“ oder: „Wie können wir das Ruder herumreißen?“ und „Wie kriegen wir unsere Aufgaben weiterhin gestemmt?“
Oder aus der Perspektive der Schönstatt-Bewegung: „Was sollen – z. B. – wir Schönstätter tun?“
Sondern die erste Frage lautet und muss lauten: „Wer wollen wir sein?“ – oder anders formuliert: „Wer sind wir und woraus leben wir?“ – „Wer bin ich und woraus lebe ich?“ – „Wo ist die Mitte, die mich trägt?“
Dieses gemeinschaftliche und persönliche Charisma, das innere Feuer, das brennt, die persönliche Identifikation gilt es zunächst in den Blick zu nehmen. Das ist ja das Erste, was geistliche Bewegungen und ihre Menschen der Kirche anbieten können: eine persönliche Identifikation mit Jesus Christus, die sich speist aus einem starken Gründungscharisma.
Und genau das bringe ich ein … Und zwar bringe ich es nicht ein als Norm, als gewünschten Normalfall, als Rezept oder gar guten Ratschlag für andere. Alle diese Erwartungen an andere nicht! Sondern ich bringe es ein als Meines, als mein Charisma, das mich prägt und trägt in dieser Zeit der Kirche. Ohne jeden Proselytismus, wie Papst Franziskus es nennen würde, ohne werbende Absicht …
Identifikation statt Aktionismus, das wäre das Erste, was die geistlichen Bewegungen in dieser Zeit der Kirche anbieten können – und zwar in einer größtmöglichen Absichtslosigkeit.
b. Mehr Niederschwelligkeit als ausgeprägte Pflege der Binnenkultur
Eine Zweites braucht die Kirche in dieser Zeit von den geistlichen Bewegungen: den Mut zur Niederschwelligkeit.
Was meine ich damit? Ich formuliere es jetzt mal etwas provozierend …
Es ist ja schön, wenn Sie sich hier in Schönstatt zu Hause fühlen, wenn wir uns an unseren geistlichen Zentren zu Hause fühlen. Aber wenn diese geistlichen Zentren in ihrer Formensprache, ihrer Ästhetik, ihrem Vokabular, ihren Veranstaltungstypen Barrieren aufbauen, die selbst von andernorts gut sozialisierten Katholiken nicht zu nehmen sind, dann läuft etwas schief oder ist zumindest mit Fragen zu versehen.
Ich weiß, dass es die vielen schönstättischen Formate gibt, die diesem Anliegen der Niederschwelligkeit große Aufmerksamkeit schenken. Aber da ist noch viel Luft nach oben. Es ist viel Luft nach oben, das, was unsere geistlichen Zentren zu bieten haben, so anzubieten, dass hier Menschen andocken können, die im Umbruch von der Volkskirche zur Kirche des Volkes Beheimatung suchen – oder auch nur eine kurze Atempause oder die Möglichkeit zur Tuchfühlung mit der Botschaft Jesu aus einem gewissen Abstand zur Kirche heraus.
Ich glaube, von hier aus wäre es wichtig, sehr schonungslos, sehr ehrlich – und im Austausch mit Menschen, die nicht zur Schönstatt-Bewegung gehören – diese Frage nach den inneren Barrieren zu stellen. Fragen Sie Menschen von außen hierzu, „Fremdpropheten“ würden die Trierer das nennen …
Die Antworten, die von dort kommen, können durchaus irritieren und wehtun. So ist das mit Propheten. Die Schönstatt-Bewegung hat das Prophetentum nicht gepachtet …
Ehrliche Fragen stellen: Wo haben wir Barrieren aufgebaut? Wozu? Brauchen wir sie – noch? Wofür? Wie viel Arkandisziplin braucht eine geistliche Bewegung und eine Gemeinschaft oder Schönstatt-Gruppe, um ihre Identität zu wahren?
Barrierefreiheit ist nicht nur ein Thema für Rollstuhlfahrer und Gehörlose. Es ist auch ein Thema der inneren Barrieren, die wir durch religiöse Sprache, liturgische Formen, Inventar etc. aufbauen oder auch abbauen. Ich meine, hier wären maximale Wagnisse gefragt, um das, was in der eigenen Bewegung ohne Zweifel an Reichtum da ist, auch möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Die Kirche braucht sozusagen die Bereitschaft der geistlichen Bewegungen, ihre „Wagen auf Niederflurbetrieb umzustellen“, auf Barrierefreiheit.
Soweit zum Stichwort „Mehr Niederschwelligkeit als ausgeprägte Pflege der Binnenkultur“.
c. Investition in Kleine Christliche Gemeinschaften
Wenn es stimmt, dass wir auf dem Weg sind von der Volkskirche zu einer Kirche des Volkes, dann wird die Frage bedeutsam, wo und wie sich diese Kirche des Volkes sozialisiert. Wie können neue Vergemeinschaftungen aussehen, wenn die alten wegbrechen? Wo und wie finden sich hier Menschen? Was tun sie miteinander? Was verbindet sie? Wem dienen sie?
Die Trierer Synode hat im Kontext dieser Fragen das Stichwort von den Kleinen Christlichen Gemeinschaften ins Spiel gebracht. Seit der Jahrtausendwende gibt es in verschiedenen deutschen Bistümern verstärkte Bemühungen, diesen Ansatz der Kleinen Christlichen Gemeinschaften, der ursprünglich in Afrika, Asien und Südamerika entwickelt wurde, im Kontext unserer entstehenden Großpfarreien einzuführen und zu erproben.
Was zeichnet eine solche kleine christliche Gemeinschaft aus? Das Stichwort „Kleine Christliche Gemeinschaften“ beschreibt eine neue Art, Kirche zu sein und hat folgende Elemente:
- Gemeinschaft: Regelmäßige Treffen als „Kirche vor Ort“ im Bereich der Nachbarschaft, des sozialen Nahraumes, der Siedlung bzw. des Dorfes (normalerweise in Privatwohnungen).
- Spiritualität: Gemeinsames Gebet und Bibel-Teilen als liturgische Feier der Gegenwart Jesu im Wort der Schrift und in der Gemeinschaft.
- Handeln: Soziales und kirchliches Handeln sind integriert; das Hören auf das Wort Gottes hilft der Kleinen Christlichen Gemeinschaft, ihre Sendung zu entdecken und sensibel wahrzunehmen, was ihre konkrete Aufgabe hier und jetzt für ihren konkreten Lebensraum und für die Pfarrei ist, zu der sie gehört.
- Kirche: Jede Kleine Kirchliche Gemeinschaft sucht die Vernetzung mit der Pfarrei und damit mit der gesamten Kirche. Durch konkrete Vernetzungsstrukturen (Beauftragungen, Treffen der KCG-Leiter mit der Pfarreileitung, Schulungen u. v. m.) ist die Kleine Christliche Gemeinschaft mit der gesamten Kirche verbunden.
- Leitung: Leitung wird in diesem Gemeinde-Modell idealerweise nicht hierarchisch, sondern partizipativ wahrgenommen. Es geht darum, Menschen zu stärken und zu selbstständigem Engagement zu befähigen.
(Vgl. Wikipedia-Artikel zu den KCG; vgl. auch Christian Hennecke (Hg.): Kleine Christliche Gemeinschaften verstehen, Würzburg, 2009; http://www.weltkirche.bistum-trier.de/themen/kleine-christliche-gemeinschaften)
Es wird Ihnen aufgefallen sein: Einige Elemente dieser Kleinen Christlichen Gemeinschaften finden sich auch in verschiedenen Engagements der Schönstatt-Gruppen und z. B. des Apostolates der Pilgernden Gottesmutter. Wir haben hier gewisse „Wiedererkennens-Effekte“!
Von diesen Gemeinsamkeiten her stellt sich die Frage, ob es nicht insbesondere für Menschen aus dem schönstättischen Erfahrungsraum interessant sein könnte, sich in die derzeitige Pionierphase der Kleinen Christlichen Gemeinschaften in den Pfarreien einzubringen:
- Sie könnten ihre Erfahrung mit gruppenbildenden Prozessen einbringen
- die spirituelle Motivation
- die Freude am Apostolat
- die Bereitschaft zum sozialen Engagement
- und vor allem ihre christlichen Identifikation.
Klar müsste allerdings auch sein, dass es hier um ein außerschönstättisches Engagement geht, dem nicht das Anliegen zugrunde liegt, Menschen für die Bewegung zu gewinnen. Es ginge sozusagen „nur“ um einen selbstlosen Dienst am Gemeinschafts- und Gemeindeaufbau in der derzeitigen Umbruchssituation der deutschen Kirche.
Natürlich könnte sich nicht die Bewegung als solche oder eine ganze Gliederung oder Gruppe für dieses Engagement entscheiden, sondern es ginge um den Einsatz Einzelner, die sozusagen auf dem Außenposten ihres Alltages und Wohnortes einen Dienst leisten möchten in der Kirche und für die Kirche.
Nur so eine Idee, die ich Ihnen vortragen möchte. Schauen Sie, was Sie damit machen.
Zum Schluss noch einmal diese drei Stichworte in Ihre Runde hinein, die mich bewegen bei der Frage, was die Schönstatt-Bewegung einbringen könnte in die aktuelle kirchliche Situation hinein:
a. Identifikation statt Aktionismus
b. Mehr Niederschwelligkeit als ausgeprägte Pflege der Binnenkultur
c. Investition in Kleine Christliche Gemeinschaften
Ich danke Ihnen!
Spenden zur Unterstützung des Büros des Bewegungsleiters sind – auch gegen Spendenquittung – möglich auf folgende Konten: Schönstatt-Bewegung Deutschland –
Bank im Bistum Essen – IBAN DE 07 3606 0295 0029 6200 24 – BIC GENODED1BBE
oder Sparkasse Koblenz – IBAN DE11 5705 0120 0000 1420 91 – BIC MALADE51KOB