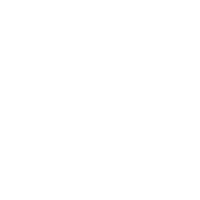Nachrichten
Begegnung mit Zukunft – Kulturen und Religionen in unserem Land – Impuls 2
Begegnung mit Zukunft – Kulturen und Religionen in unserem Land – Impuls 2
Bürgermeister Christoph Ewers, Burbach
DOWNLOAD: PDF-Version
15. Oktober 2016
Sehr geehrte Damen und Herren,
nach den philosophischen und eher grundsätzlichen Ausführungen von Professor Dr. Söder ist es meine Aufgabe als Bürgermeister, bei diesem Dialogreferat zum Thema Kulturen und Religionen in unserem Land etwas von den praktischen Erfahrungen vor Ort, also aus dem kommunalpolitischen Alltag, insbesondere vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise zu berichten und diese Erfahrungen auch in ein paar allgemein-politische Aussagen einzubinden.

Christoph Ewers (Foto: PressOffice, K. Kröper)
- Ich bin seit 13 Jahren hauptamtlicher Bürgermeister in der Gemeinde Burbach
- Burbach ist eine ländlich geprägte Gemeinde mit 15.000 Einwohnern im Dreiländereck NRW, HE, RP
- Seit Herbst 2013 gibt es in Burbach eine Erstaufnahmeeinrichtung des Landes NRW für Flüchtlinge mit einer Regelbelegung von 500 Flüchtlingen. Teilweise war die Einrichtung mit bis zu 900 Flüchtlingen belegt. In der unmittelbaren Nachbarschaft eine ähnliche Einrichtung des Landes Rheinland-Pfalz mit ebenfalls einigen hundert Flüchtlingen, die inzwischen allerdings geschlossen ist.
- Ich bin seit 25 Jahren verheiratet, 4 Kinder im Alter zwischen 24 und 13
- In Schönstatt bin ich zusammen mit meiner Frau seit 20 Jahren im Familienbund aktiv
Vor die Schilderungen meiner Erfahrungen vor Ort möchte ich einige allgemeine Bemerkungen zur politischen Diskussion zum Thema stellen.
Die Frage des Umgangs mit verschiedenen Kulturen und Religionen in unserem Land ist auch in der Politik keine grundsätzlich neue. Sie spiegelt sich in verschiedenen Diskussionen auf Bundes- und Landesebene der letzten Jahre und Jahrzehnte wieder. Ich erinnere an den Begriff der „multikulturellen Gesellschaft“, der im Zusammenhang mit der Einwanderungs- und Integrationspolitik insbesondere von der politisch Linken als gesellschaftspolitischer Anspruch in den 80er-Jahren geprägt wurde. Es gab die Diskussion um eine „Leitkultur“, ausgelöst durch eine Rede des damaligen CDU-Abgeordneten Friedrich Merz im Jahr 2000, der von vielen als konservative Gegenposition zur Forderung nach einer multikulturellen Öffnung der Gesellschaft verstanden wurde. Nach heftigen Diskussionen wurde der Begriff der „Leitkultur“ sogar zum Unwort des Jahres 2000. Der damalige CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt definierte im Jahr 2010 – also lange vor der Flüchtlingskrise – die „Deutsche Leitkultur“ als „das Christentum mit jüdischen Wurzeln, geprägt von Antike, Humanismus und Aufklärung“. Weitere Diskussionen und Formulierungen in Parteiprogrammen ließen sich aufzählen. Ich möchte hier diese Definitionen mit ihren Unschärfen und missverständlichen Formulierungen oder auch Interpretationen nicht bewerten, sondern lediglich deutlich machen, dass es nicht nur in akademischen Kreisen an Universitäten, sondern auch auf dem politischen Parkett in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder Debatten oder zumindest Debattenansätze zur Frage des Umgangs mit anderen Kulturen und Religionen bzw. zum kulturellen und religiösen Selbstverständnis der eigenen Gesellschaft in einer immer globaler werdenden Welt, in einer immer säkularer werdenden Gesellschaft gegeben hat.
Meiner Beobachtung nach ist aber diese Diskussion an der Basis der Bevölkerung mangels konkreter Betroffenheit eher vorbeigegangen. Sicherlich, es gab vielleicht die türkischen Arbeitskollegen, die ihre Gebetszeiten im Betrieb organisieren wollten, es gab hier und da heftige Diskussionen um einen Moscheeneubau in der Nachbarschaft oder Diskussionen um die Teilnahme muslimischer Mädchen am Schwimmunterricht, aber für die breite Masse der Bürgerinnen und Bürger waren dies eher weniger relevante Themen.
Dies hat sich allerdings mit der Flüchtlingskrise radikal geändert. Das Thema ist mit einer ungeahnten Wucht und Präsenz in das Bewusstsein breiter Teile der Gesellschaft gebracht worden. Nicht nur jeder Stammtisch, sondern auch alle Medien, die Frühstücks- oder Mittagstische in den Familien und natürlich auch die kommunalpolitischen Diskussionen waren auf einmal von diesem Thema geprägt und sind es nicht unwesentlich bis heute.
Das war auch in Burbach so – und damit komme ich zur konkreten Erfahrung vor Ort. Ohne Vorbereitungsmöglichkeit waren Bevölkerung und Institutionen auf einmal durch die sehr kurzfristig eingerichtete große Notunterkunft, die dann in eine Erstaufnahmeeinrichtung überführt wurde, einer riesigen Herausforderung ausgesetzt. Flüchtlinge aus unterschiedlichen Ländern prägten plötzlich das Ortsbild und lösten sowohl Hilfsbereitschaft aber auch Unsicherheit, Ängste und Ablehnung aus. Die Beobachtungen, die ich dabei in vielen Begegnungen, Gesprächen und Treffen machen konnte, waren so facettenreich und vielschichtig wie die Gesellschaft selbst. Ich will sie deshalb etwas zusammenfassen, indem ich drei typische Reaktionsmuster nenne – betont ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
1. Es gab und gibt einen Teil der Bevölkerung, der sehr ablehnend und dabei teilweise auch erschreckend aggressiv reagiert. Ablehnung und Aggressivität werden mit den uns allen tagtäglich begegnenden Argumenten pauschal begründet. Überfremdung bzw. Islamisierung der Gesellschaft, Kriminalisierung der Gesellschaft, Missbrauch der Sozialsysteme. Sie alle kennen die Pegida- und AfD-Parolen zur Genüge. Hintergrund dieser Einstellung sind ganz offensichtlich Angst und Enttäuschung. Angst vor Wohlstandsverlust. Angst, dass die gewohnte überschaubare Welt sich verändern wird. Angst vor Fremdbestimmung. Angst, dass unsere gewohnte Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Es ist oft die Angst derer, die sich ohnehin schon benachteiligt fühlen, derer, die meinen, zu kurz zu kommen in unserer Gesellschaft. Zu dieser Angst kommt das Gefühl, dass die etablierten Parteien und Institutionen nicht gewillt oder in der Lage sind, diesen Veränderungen etwas entgegenzusetzen. Die Komplexität der globalen Welt verunsichert. Klare, einfache Standpunkte und Antworten sind nicht erkennbar. Viele Bürger fühlen sich von Intellektuellen, Politikern und den etablierten Medien nicht ernst genommen und vertreten. Angst verlangt nach einfachen Antworten. Angst ist deshalb bekanntlich das Einfallstor für Propaganda. Das erleben wir derzeit in ganz Europa.
Die Menschen dieser Gruppe sind oft schwer ansprechbar. Sie sind misstrauisch, in ihrer Meinung festgelegt und auch nicht zwingend organisiert, was die Ansprechbarkeit erschwert. Man darf diese Gruppe der Bevölkerung allerdings nicht unbeachtet lassen. Jede Form von Überheblichkeit ist schädlich und verfestigt die Positionen. Wir müssen versuchen, Zugänge zu diesen Menschen zu bekommen. Wir versuchen das in der Kommunalpolitik über Vereine, Dorfgespräche, Bürgerversammlungen, über politische Parteien, über Schulen, über Kirchengemeinden. Es gibt keine Alternative zu persönlicher Ansprache, Dialog, Begegnung. Das ist mühselige Kleinarbeit. Menschen, die vermeintlich bereits Verlierer in dieser Gesellschaft sind, dürfen aber nicht alleine gelassen werden. Der Anteil dieser Gruppe an der Gesamtbevölkerung ist in Burbach Gott sei Dank überschaubar, bei weitem nicht so groß wie in manchen ostdeutschen Kommunen, und war auch in der ersten Zeit, in der die Herausforderung besonders groß war, nie in der Lage, zum Beispiel meinungsbildend auf kommunalpolitische Gremien einzuwirken. Ich bin mir aber bewusst, dass dies nicht zwingend so bleiben wird. Wir haben bei Kommunalwahlen landauf, landab eine Wahlbeteiligung von lediglich um 50 %. Wie viel Potenzial an antidemokratischer Stimmung liegt in der Hälfte der Bevölkerung, die nicht wählen geht? Wir wissen es nicht.
2. Eine zweite Gruppe ist ebenfalls ängstlich, aber eher zurückhaltend. Darunter sind viele Menschen, die eine – häufig auch unbestimmte – Angst haben, dass die Gesellschaft sich verändert, dass unser Bildungssystem und unsere Sozialsysteme überlastet werden und dass damit auch unser Wohlstand und damit die eigene Zukunft und die der Kinder negativ beeinträchtigt werden. Es sind eher gesellschaftlich etablierte Menschen mit mittlerem bis höherem Einkommen. Viele sind typische Wähler der großen Volksparteien. Innerhalb dieser Gruppe von Menschen erlebe ich eine größer werdende Unsicherheit, wie man sich politisch orientieren soll. Es sind Menschen, die wir eher erreichen, Menschen die über Veranstaltungen, Medienarbeit u. Ä. angesprochen werden müssen.
3. Eine dritte Gruppe stellen die Menschen dar, die sozial engagiert sind und die auch in der Flüchtlingsarbeit aktiv sind. Gott sei Dank sind dies in Burbach sehr viele Menschen. Sie setzen sich ehrenamtlich und auch nachhaltig und teilweise mit großem zeitlichem Einsatz ein. Dieses soziale Engagement kann ganz unterschiedlich motiviert sein. In Burbach sind es überwiegend Menschen aus Kirchengemeinden und anderen christlichen Gruppierungen, die ich einmal als Teilgruppe herausgreifen möchte, weil sie für das Thema besonders interessant ist. Unsere Region ist stark reformiert-protestantisch geprägt, in den Kirchengemeinden landeskirchlich organisiert, darüber hinaus gibt es aber noch zahlreiche freikirchliche Gruppierungen.
In der Erstaufnahmeeinrichtung lebten bzw. leben überwiegend Menschen muslimischen Glaubens. Die meisten Menschen bleiben nur wenige Wochen in der Einrichtung, bevor sie dann endgültig anderen Kommunen für die Zeit ihres Asylverfahrens zugewiesen werden. Die Hauptaktiven aus den genannten christlichen Gruppierungen waren Helfer der ersten Stunde und prägen das Engagement bis heute. Von Anfang an waren sie von der Überzeugung getragen, dass sie als Christen aus dem Gebot der Nächstenliebe heraus zur Hilfe gefordert sind und diese Hilfe allen Menschen zuteil kommen muss – unabhängig von deren Kultur oder Religion. Gleichzeitig – und da haben die bei uns prägenden protestantischen Gruppierungen meiner Beobachtung nach ein größeres Sendungsbewusstsein als wir Katholiken – wollten sie ganz bewusst auch die christliche Botschaft mitteilen.
Auch wenn es in der Flüchtlingseinrichtung in erster Linie um praktische Hilfe geht – von der Kleidersammlung über Kinderbetreuung und Sprachunterricht bis hin zur Vermittlung von Kenntnissen unserer Alltagskultur und des Verhaltens in unserer Gesellschaft –, wurde von den Helferinnen und Helfern von Beginn an gefordert, auch einen Gebetsraum einrichten zu können, dort wöchentlich christliche Gottesdienste abhalten zu dürfen, zu denen man auch alle Muslime einladen wolle, und auch die christlichen Feste wie Ostern, Weihnachten und Pfingsten in der Einrichtung öffentlich feiern zu können. Das stieß bei den Verantwortlichen des Landes NRW zunächst auf großen Widerstand, der mit der staatlichen Neutralitätspflicht, mit der Befürchtung von Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen religiösen Gruppierungen und der Befürchtung, dass dann muslimische Gruppierungen mit ähnlichen Forderungen kommen könnten, begründet wurde. Schließlich setzten sich die Helfer aber durch, und zur Überraschung vieler gibt es eigentlich ausschließlich positive Erfahrungen zu berichten. Bis heute wird in der Einrichtung jeden Mittwoch ein Gottesdienst gefeiert und ins Englische und Arabische übersetzt. In aller Regel ist dabei die Anzahl der Muslime deutlich höher als die Anzahl der Christen. Manche hören schlicht zu, manche singen aber auch mit. So hat sich zum Beispiel ein Halleluja-Lied als „Schlager“ durchgesetzt, das immer wieder mit Beteiligung vieler Muslime gesungen wird und mit dem man gelegentlich von Kindern in der Einrichtung begrüßt wird. Es gibt immer wieder Gespräche über Religion, über Unterschiede von Islam und Christentum. Jeden Sonntag kommen Christen und Muslime in den evangelischen Gemeindegottesdienst.
Die Unbefangenheit von Flüchtlingen, auch dem religiös anderen oder Neuen zu begegnen, war und ist deutlich größer als erwartet. Vielleicht liegt es daran, dass viele Flüchtende grundsätzlich bereit sind, sich auch Neuem zu stellen. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Verständnis dafür, dass Menschen religiös motiviert handeln, im Islam noch größer ist, als bei uns. Aber in erster Linie ist es wohl die positive Erfahrung offener und hilfsbereiter Begegnung, welche die Menschen öffnet für das andere. Die Flüchtlinge machen zunächst einmal die Erfahrung, dass da Menschen sind, die Ihnen offensichtlich selbstlos helfen, die ihnen freundlich entgegentreten, die zuhören, sich ihre Geschichte erzählen lassen, die ihnen Gutes tun. Und gleichzeitig erleben sie, dass diese selbstlos tätigen Menschen religiös motiviert sind, davon auch erzählen und sie einladen, mitzufeiern und ihre Traditionen, Riten und Bräuche miterleben zu lassen.
Umgekehrt setzen sich die Helfer neu mit ihrer Religion auseinander – müssen erzählen, erklären, begründen.
Warum erzähle ich das? Diese Erfahrungen stehen im Gegensatz zu einer Tendenz des zunehmenden Rückzuges des Religiösen ins Private in einer immer säkularer werdenden Welt und in einer Gesellschaft, in der die Anzahl der Andersgläubigen ständig wächst. Ich halte es für eine spannende und wichtige Frage, wie und wo und in welchem Rahmen wir öffentlich Religion leben oder leben sollten. Ich halte es für eine häufig zu beobachtende falsch verstandene Toleranz, das Religiöse – oft mit der Begründung, nicht ausgrenzen zu wollen – in der Begegnung mit Andersgläubigen aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Auf der anderen Seite muss jede Form von Aufdringlichkeit vermieden werden. Ein christliches Bekenntnis schließt die vorbehaltlose Anerkennung Andersgläubiger ein und ermöglicht damit einen vorurteilsfreien Dialog.
Auch aufseiten der Politik und staatlicher Stellen wird unter Berufung auf eine – meines Erachtens – falsch verstandene Neutralitätspflicht immer wieder religiös motiviertes Engagement kritisch betrachtet. Unsere Verfassungstexte sprechen eigentlich eine andere Sprache. Die meisten Landesverfassungen enthalten sogar einen religiösen Auftrag für Politik und Regierungen. Nehmen wir als Beispiel die NRW-Verfassung, gerade weil NRW nicht als Hort des Konservativen gilt. Dort kann man zum Beispiel in Artikel 7 lesen:
„Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Bildung.“
Ehrfurcht vor Gott als erstes Bildungsziel! Das verträgt sich nicht mit der staatlichen Verbannung des Religiösen aus seinen Einrichtungen.
Der Gott der Verfassungen ist natürlich weder exklusiv katholisch, evangelisch, jüdisch oder islamisch – auch wenn in einigen Verfassungen, wie zum Beispiel in denen von BW und Saarland explizit auf christliche Werte Bezug genommen wird. Aber Gott wird vorausgesetzt. Er ist – jenseits konkreter Gottesvorstellungen einzelner Religionen – zumindest ein „ein dogmatisch unbestimmter Garant für Menschenwürde und Gerechtigkeit. Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen, diesen Gottesbegriff mit den Gottesvorstellungen ihrer je eigenen konfessionellen Tradition näher zu bestimmen. Dazu gehört natürlich, dass die Grundsätze unserer Verfassung und unseres Gemeinwesens mit dieser Gottesvorstellung überein zu bringen sind.“[1]
Ich bin mir nicht sicher, ob diese Grundlagen der Verfassung heute noch bei einer Mehrheit der Bevölkerung Akzeptanz finden, aber je drängender sich diese Frage stellt, umso mehr gilt es doch für die, die von den christlichen Wurzeln unserer Gesellschaftsordnung überzeugt sind, diese auch zu betonen und transparent zu machen. Viele meinen ja, dass die christlichen Wurzeln unserer Verfassung heute keine Relevanz mehr für deren Bestand haben. Man darf sich aber die Frage stellen, ob auf Dauer die Loslösung der Grundrechte von ihren Wurzeln, die Loslösung von dem Glauben an einen Gott, vor dem alle Menschen gleich sind, die Loslösung von einem Glauben an die Gottebenbildlichkeit des Menschen, aus dem heraus sie letztlich entstanden sind, nicht auch die Grundrechte selbst gefährdet. Schafft eine Gesellschaft es auf Dauer, diese Grundrechte alleine aus der Vernunft, aus der historischen Erfahrung ihrer positiven Wirkung heraus zu erhalten? Bilden diese Grundrechte eine Art „evolutives Niveau“, hinter das wir nicht mehr zurückfallen können, weil Aufklärung, Wissenschaft und „humanistisches Gedankengut“ uns weit genug gebracht haben? Daran habe ich Zweifel.
Auch wenn Bilder immer hinken, erlaube ich mir, eines zu wählen: Das erscheint mir fast so, als ob man aus der Tatsache, dass man die Wurzeln eines starken und stabilen Baumes nicht sieht, schließen möchte, dass man sie auch nicht braucht, dass das, was man über der Erde sieht und auf den ersten Blick aus sich selbst heraus Stabilität zu versprechen scheint, auch tatsächlich stabil ist. Das ist gefährlich. Wenn man den Stamm nach und nach von seinen Wurzeln trennt, wird er nicht nur zunehmend vertrocknen und an Wachstum verlieren, sondern auch an Stabilität. Ich befürchte, mit den Grundrechten und unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung könnte es ähnlich gehen. Das bedeutet keine Forderung zurück zum Christentum als Staatsreligion. Darauf ist das Christentum auch eigentlich biblisch nicht angelegt („… gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist …“), die Zeit ist gottlob vorbei. Wir können aber aus unserem christlichen Glauben heraus die Grundwerte unserer Verfassung begründen, stützen und verteidigen und im Sinne der Religionsfreiheit auch alle Religionen, die dies ebenfalls tun.
Das erscheint mir besonders wichtig, weil der demokratisch verfasste Staat eine bestimmte Haltung oder Gesinnung nicht erzwingen kann und damit auch den Fortbestand seiner demokratischen Grundordnung nicht. Darauf hat der ehemalige Bundesverfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde bereits 1976 hingewiesen mit seiner als „Böckenförde-Diktum“ berühmt gewordenen Formulierung, dass der freiheitliche, säkularisierte Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das Wagnis – so hat er es genannt – unserer Demokratie. Es bedarf daher, so hat Böckenförde damals schon gesagt, der „ethischen Prägekraft“ der Christen.
Die Flüchtlingskrise und die dadurch ausgelösten Diskussionen zu den Grundlagen unserer demokratischen Grundordnung sind eine große Herausforderung, aber sie bieten auch die Chance, dass größere Teile der Gesellschaft sich Gedanken machen, dass unsere Errungenschaften nicht selbstverständlich sind und dass man sich vielleicht auch wieder stärker mit den Wurzeln befasst.
Dafür brauchen wir die intellektuelle Auseinandersetzung mit diesem Thema, zu der Wissenschaft, Kirchen und Politik aufgerufen sind. Unsere Bildungseinrichtungen müssen dies stärker reflektieren. Das reicht aber nicht aus. Wir brauchen dafür aber ganz besonders auch die Begegnung der Kulturen und Religionen vor Ort, wir brauchen gelebten Glauben – auch in der Öffentlichkeit. Dazu wird jeder gebraucht. Jeder, dem der christliche Glaube wichtig ist, jeder, dem unsere in den Verfassungen grundgelegten Werte wichtig sind, kann in seinem Umfeld für deren Erhalt tätig werden.
Als Schönstätter mit unserer ausgeprägten Bündniskultur können wir einiges dazu beitragen. Das Jahresmotto „Er kam hinzu und ging mit Ihnen“ lädt dazu ein. Deshalb möchte ich zum Schluss gerne Pater Kentenich zitieren, der zu Beginn der 60er-Jahre bereits Folgendes gesagt hat:
„Danach ist der neue Menschen- und Gemeinschaftstyp – negativ gesehen – […] der anti-relativistische Mensch in einer gleichgearteten Gemeinschaft. Dabei darf das ‚Anti‘ in den bezeichneten verschiedenen Formen und Gestalten nicht falsch gedeutet werden. Es bedeutet keine feindliche Gegeneinstellung, sondern eine gütig-wohlwollende, ehrfürchtige Freiheitshaltung jeglicher anderen Art gegenüber; hütet sich aber sorgfältig vor öder Gleichmacherei und vor Haltlosigkeit in Kopf und Wille und Herz. Man vergesse nicht, dass die heraufsteigende Zeit – ob wir wollen oder nicht – eine wohlwollend-duldsame Koexistenz der verschiedenen Glaubensbekenntnisse nebeneinander verlangt und rechtfertigt. Gerade deshalb ist bei aller Ehrfurcht vor fremder Überzeugung die Betonung des geistigen ‚Anti‘ so eminent wichtig.“[2]
Dem gilt es auch heute nichts hinzuzufügen.
[1] Rolf Schneider, Theologe aus Berlin in der ZEIT-Beilage Christ und Welt, Nr. 41 vom 29.9.2016.
[2] Kurz-Studie 1963. In: Fürchte dich nicht, 1647 f.
Spenden zur Unterstützung des Büros des Bewegungsleiters sind – auch gegen Spendenquittung – möglich auf folgendes Konto:
Schönstatt-Bewegung Deutschland – Bank im Bistum Essen – IBAN DE 07 3606 0295 0029 6200 24 – BIC GENODED1BBE