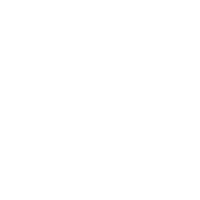Nachrichten
Begegnung mit Zukunft – Kulturen und Religionen in unserem Land – Impuls 1
Begegnung mit Zukunft – Kulturen und Religionen in unserem Land – Impuls 1
Professor Dr. Joachim Söder, Aachen
DOWNLOAD: PDF-Version
15. Oktober 2016
Drei Thesen
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
gestatten Sie bitte, dass ich mit einem persönlichen Erlebnis beginne.

Prof. Dr. Joachim Söder (Foto: PressOffice, H. Brehm)
Ein Facebook-Post
Kurze Zeit, nachdem Pater Güthlein freundlich drängend nachgefragt hatte, wie weit ich mit den Vorbereitungen zum Dialogreferat „Kulturen und Religionen in unserem Land“ sei und ob ich ihm schon ein paar Thesen melden könnte, kam mir ganz unerwartet eine Nachricht aus der digitalen Welt zu Hilfe.
Am 12. September 2016 stellte ein Bekannter, von Beruf Philosophielehrer, bei Facebook zusammen mit dem Bild der knotenlösenden Gottesmutter folgenden Post ins Netz: „Voll Dankbarkeit können wir heute Mariä Namen feiern. Aufklärung, Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit verdanken wir der Tatsache, dass das Christentum die Leitkultur Europas blieb.“
Die Werte Aufklärung, Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit werden hier aufs Engste mit dem Christentum und seiner spezifisch europäischen Geschichte in Verbindung gebracht, es scheint in diesem Post etwas auf, was man andernorts vielleicht die heilsgeschichtliche Sendung des Abendlandes nennen könnte. Hinter dieser Verbindung kultureller Werte mit einer historischen Gestalt von Religion steckt wohl nicht die Behauptung, dass Aufklärung, Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit exklusiv auf das Christentum beschränkt wären – es ließen sich ja zahlreiche Gegenbeispiele anführen. Viel eher spricht sich hier die Einsicht aus, dass überzeitliche und als solche abstrakte Werte zu ihrer Verwirklichung eines konkreten historischen Katalysators bedürfen: Das Christentum, wie es sich in einem jahrhundertelangen Prozess in Europa realisiert hat, hat Erfahrungen ermöglicht, die kollektiv als sinnstiftend empfunden werden.
Lassen Sie mich dies an einem Beispiel illustrieren: Von Anfang an versteht sich das Christentum, die Religion des menschgewordenen Logos, nicht als blinder, irrationaler Glaube, sondern als eine „vernünftige Gottesverehrung“ (logikê latreia: 1 Kor 12,1). Der Erste Petrusbrief fordert die Gemeinde ausdrücklich auf, „jedem jederzeit Rede und Antwort zu stehen, der nach einem Grund (logos) für eure Hoffnung fragt“ (1 Petr 3,15). Das Sich-in-Frage-stellen-Lassen und die Bereitschaft, für die religiöse Überzeugung mit Gründen, mit Argumenten einzustehen, führen zur Entwicklung einer an wissenschaftlichen Maßstäben orientierten Theologie. Verstärkt wird dieser Prozess innerhalb des westeuropäischen Christentums dadurch, dass die lateinische Theologie des Mittelalter – im Unterschied zur orthodoxen Tradition – sich der säkularen Philosophie des Aristoteles aussetzt, ja diese selbst in die dogmatische Argumentation etwa der Transsubstantiationslehre aufnimmt. Es ist der Versuch, die tiefen Mysterien des Glaubens anderen dadurch mitteilbar zu machen, dass sie sachlich und nachvollziehbar begründet werden. Der Appell an das vernünftige Verstehen ersetzt nicht den Glaubensvollzug, aber er schlägt eine Brücke zu ihm. Sich der kritischen Prüfung rationaler Argumentation zu vergewissern, ist dieser geschichtlich konkreten Form der Religion eigen – der Weg zur Aufklärung im Sinne Kants („Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“) gebahnt. Die Folgen einer solchen Auffassung sind die Hochschätzung des Gewissens sowie der Respekt vor der individuellen Person und ihrer unantastbaren Würde – Werte, die heute tief in die weltliche Kultur und Rechtsordnung eingesickert sind und als sinnhaft und identitätsbildend erfahren werden.
Dies führt mich zu meiner ersten These:
These 1:
Kulturen sind Ausdruck gemeinschaftlich erfahrenen Sinns.
Die an sich überzeitlichen Werte gewinnen ihre Prägekraft stets in konkreten historischen Konstellationen, in denen Menschen Sinnerfüllung erfahren. Gemeinsame Erfahrungen profilieren das kollektive Selbstverständnis und lassen spezifische Praktiken des Miteinanders entstehen, die sich als Traditionen, als wiederkehrende Erinnerungen an die Sinnerfahrung, fortsetzen.
Wenn dies zutrifft, liegt das Fundament einer Kultur in geteilten Wertüberzeugungen, nicht in biologisch-genetischen Merkmalen einer Menschengruppe. Wer Letzteres vertreten würde, müsste konsequenterweise auch einräumen, dass es zwischen Kulturen grundsätzlich keine Verständigung geben kann, ähnlich wie es auch zwischen biologischen Organismen unterschiedlichen Genoms
– etwa Katze und Hund – grundsätzlich keine Verständigung gibt. Eine solche Auffassung ist nicht nur rassistisch, sondern leistet auch dem schlimmsten Irrationalismus Vorschub: Wo für kulturelle Werte und Überzeugungen nicht mehr mit Argumenten eingetreten werden kann, bleibt nur noch der Weg der Konfrontation, des „Kampfs der Kulturen“[S. Huntington]. Palmyra und Timbuktu sind Chiffren einer extrem irrationalistischen, kulturvernichtenden und menschenmordenden Kulturauffassung geworden. Wer dies nicht will, sollte auch in unserem Land dem oberflächlichen Gerede von der Unvereinbarkeit der Kulturen, wie es nicht nur von „besorgten Bürgern“, sondern auch von manchen Politikern gepflegt wird, beherzt entgegentreten. Denn für kulturelle Werte kann mit Argumenten geworben werden, erfahrener Sinn kann einsichtig gemacht, im besten Fall sogar nachvollzogen werden.
Menschen an der eigenen Sinnerfahrung teilhaben zu lassen, ist beglückend; selbst an der Sinnerfahrung anderer teilzuhaben, bereichernd. Es stärkt die eigene Identität, wenn in der Erfahrung des Fremden etwas vom Eigenen aufleuchtet. Und wo dies nicht geschieht, wo das Fremde fremd bleibt, stellt der eigene Werthorizont immer noch ein Sinnangebot dar, für das ich werben kann.
Germanien um 730
Man stelle sich einmal folgende Situation vor: Der heilige Bonifatius durchstreift das wilde Land zwischen Nordsee und Voralpenraum und predigt überall das Christentum. Er wirbt mit Worten für sein Sinnangebot, steht Rede und Antwort, argumentiert und versucht zu überzeugen. Da tritt ihm ein Germanenhäuptling entgegen und gebietet ihm Einhalt: „Wir sind seit Jahrhunderten Heiden. Unsere Leitkultur ist der Wotanskult. Das Christentum passt nicht hierher. Geh nach Hause auf deine Insel!“ Hier hätte die Geschichte der Christianisierung Germaniens zu Ende sein können, wenn die Vorstellung richtig wäre, die sich heute in manchen Köpfen findet: Dass gewachsene, kulturell homogene Gebilde Bestandsschutz verdienen und nicht dem Wettbewerb um das bessere Sinnangebot ausgesetzt werden dürfen. Wer sagt: Deutschland ist seit Jahrhunderten ein christliches Land, der Islam passt einfach nicht hierher, benimmt sich genau so wie der fiktive Germanenhäuptling in unserem Gedankenexperiment.
Er ignoriert dabei freilich geflissentlich, dass mitten unter uns bereits 4 Millionen Muslime leben – ist deren grundgesetzlich garantiertes Recht auf freie Religionsausübung etwa mit der Einschränkung versehen: „aber bitte so, dass wir es nicht mitbekommen“? Und was bedeutet die Berufung auf die christliche Tradition in einem Land, in dem mehr als ein Drittel der Bevölkerung (28 Millionen) sich gar keiner Religion zurechnet?
Wenn heute die Verfechter des christlichen Abendlandes mutmaßlich froh sind, dass sich Bonifatius’ Sinnangebot gegen den Wotanskult durchgesetzt hat, warum haben sie Angst davor, dass mit den Muslimen, die zum Teil seit Jahrzehnten hier ansässig sind, zum Teil neu hinzukommen, ein alternatives Sinnangebot sich etabliert? Fordern sie für sich und die eigene Tradition etwas, was sie den anderen nicht zugestehen wollen? Oder zweifeln sie an der Attraktivität und Überzeugungskraft des eigenen kulturellen Werthorizonts?
Wie dem auch sei, meine zweite These lautet:
These 2:
Es gibt kein Recht auf territorial abgegrenzte Mono-Kulturen oder Kultur-Monopole, weil Sinn nicht aufzwingbar ist.
Eine selbst erlebte Sinnerfahrung lässt sich anderen nicht aufdrängen; zu verlangen, mein Gegenüber sollte ebenso empfinden und fühlen wie ich, ist absurd. Dies zeigt sich schon in der keineswegs immer gelingenden Weitergabe von Wertüberzeugungen von Generation zu Generation. Was den Älteren wertvoll, sinngebend und heilig war – Überzeugungen, Praktiken, Lebensformen –, muss bei den Jüngeren keineswegs notwendig positiv besetzt sein. Wie oft leiden Eltern darunter, dass sie an ihre Kinder die eigenen Werthaltungen und Sinnerfahrungen gerade nicht weitergeben konnten. Aber ist deren Leben deshalb ent-wertet? Vielleicht geht die Enkelin nicht mehr zur Kirche, aber möglicherweise macht sie täglich Achtsamkeitsübungen und meditiert. Und wenn schon die Sinn-Weitergabe zwischen den Generationen problematisch ist, können dann Immigranten nicht umso weniger gezwungen werden, den in der Kultur der Aufnahmebevölkerung kondensierten Sinn direkt zu übernehmen? Müssen sie ihre eigenen Sinnerfahrungen verleugnen und fremden, nicht erfahrenen Sinn übernehmen?
Freilich kann jeder versuchen, die eigene, unhintergehbare Erfahrung so zu artikulieren, dass das Gegenüber zumindest verstehen kann, was daran so befreiend, sinnstiftend oder heilsam war. Im besten Fall gelingt es sogar, den Sinngehalt soweit sprachlich zu explizieren, dass er anschlussfähig wird an die Sinnsuche des Gesprächspartners, ja dass er dem Suchenden selbst eine neue Perspektive aufzeigt. Wer also über seinen Glauben und die damit verbundenen Praktiken und Traditionen spricht, der macht dadurch stets ein Angebot, das der Diskussionspartner mit seinem eigenen Werthorizont abgleichen kann. Es ist somit keineswegs verwunderlich, dass Kulturen und Religionen, wo sie sich kommunikativ begegnen, in eine Art Konkurrenzsituation um das attraktivere Sinnangebot geraten.
Aus diesem Befund ergibt sich von selbst, dass nicht die kulturell-religiöse Einförmigkeit der Normalfall ist, sondern die Vielfalt. Ja, eine territorial abgegrenzte Mono-Kultur wäre schon deshalb nicht wünschenswert, weil sie nur über äußere Zwänge auch gegen die innere Gewissensentscheidung durchgesetzt werden könnte. Wer möchte, dass andere Menschen und Gruppen die eigenen Wertvorstellungen teilen, der muss für diese werben.
Die Karlspreisverleihung 2016
Aber führt die Erweiterung des Sinnangebots hinein in die Breite nicht zu einem beklagenswerten Verlust an Tiefe? Droht uns unter diesen Bedingungen nicht ein identitätsloser Multikulturalismus? Und verlieren wir uns nicht selbst, wenn sich die Sinnangebote der anderen als attraktiver herausstellen?
Kulturellen Wandel hat es zu allen Zeiten gegeben, nämlich stets dann, wenn alte Sinnangebote und Wertüberzeugungen ihre Überzeugungskraft einbüßten bzw. neue Sinn-Sehnsüchte und Werterfahrungen in den Vordergrund traten. Ein Beispiel aus dem innerkirchlichen Bereich mag das verdeutlichen: Jahrhundertelang war die katholische Auffassung von der Messfeier stark priesterzentriert. Im Mittelpunkt des liturgischen Geschehens stand der geweihte Amtsträger, der in lateinischer Sprache das Opfer vollzieht, während die Gemeinde, die nach dieser Ansicht auch verzichtbar ist, in Passivität verharrt oder mit Übungen der Volksfrömmigkeit (etwa dem Rosenkranzgebet oder Liedersingen) beschäftigt wird. In der liturgischen Bewegung äußerte sich die Sehnsucht vieler Gläubigen, zu verstehen, was der Priester betet, um den Ritus innerlich mitvollziehen zu können. Es entstanden die lateinisch-deutschen Parallelausgaben des Schott-Messbuchs, die diesem Anliegen Rechnung trugen. Mit dem Erstarken dieser Bewegung veränderte sich auch die Auffassung von der Rolle der Gemeinde. Sie wollte und sollte nicht mehr nur passiver Zeuge sein, sondern aktiv teilnehmen am heiligen Geschehen. Es entwickelten sich theologische Positionen, die nun der Gemeinde als solcher und den verschiedenen auch von Laien ausgeübten Aufgaben sogar eine konstitutive Funktion für die Feier der eucharistischen Mysterien zuwiesen. Die Zulassung der Volkssprache als Liturgiesprache, die bewusste Einbeziehung der Gläubigen in die Gebetsvollzüge (Wechselgebete, gemeinsames Beten, Fürbitten), die Übertragung von Diensten an Gemeindemitglieder (Lektoren-, Kantoren-, Akolythendienst) sollen dies ermöglichen und sichtbar machen. Die aktive Teilnahme aller Gläubigen am gottesdienstlichen Vollzug wird von vielen als werthaft und sinnstiftend erfahren; dass hier ein neues Sinnangebot „in Konkurrenz“ zu einem früheren tritt, zeigt sich an den bisweilen erbittert geführten Debatten zwischen Anhängern des alten und des erneuerten Ritus. Hinter beiden Formen stehen Wert- und Sinnerfahrungen. Obwohl vonseiten der kirchlichen Hierarchie die erneuerte Liturgie ausdrücklich als verbindlich angeordnet wurde, belegt die Anhängerschaft der tridentinischen Messe, dass sich Sinnerfahrungen nicht auf Befehl machen lassen. Die Tatsache, dass seit 2007 auch die „außerordentliche“, also vorkonziliare, Form der Messe neben der Normalform des erneuerten Ritus zulässig ist, erweitert die Möglichkeit, in der einen oder der anderen Form Sinn zu finden. Dass damit aber ein Verlust an Tiefe einhergehen könnte, scheint vorderhand wenig plausibel.
Doch kehren wir von einer innerkatholischen zur interreligiösen Sinn-Konkurrenz zurück. Allein durch das Faktum eines pluralen Angebots verliert die eigene Sinn-Tradition ihre Selbstverständlichkeit, und ihre Verbindlichkeit wird hinterfragbar. Besteht hier nicht die Gefahr, sich wie im Baumarkt aus den verschiedenen Sinn-Schubladen zu bedienen und eigenmächtig eine Patchwork-Religion zusammenzubasteln? Löst eine solche Selbstbedienungsmentalität nicht historisch gewachsene Gemeinschaftsidentitäten zwangsläufig auf? Wurde nicht von einschlägiger politischer und kirchlicher Seite seit Jahren vor dem nivellierenden Multikulturalismus gewarnt? Bei bedrängenden Fragen wie diesen, in die man selbst verstrickt ist, bringt häufig eine Stimme von außen Klarheit in die eigene Positionierung. Ich lade ein, zu bedenken, was ein Nicht-Europäer, der tatsächlich vom anderen Ende der Welt kommt, zur Frage der abendländischen Identität und ihrer multikulturellen Gefährdung zu sagen hat.
Am 6. Mai 2016 wurde der Internationale Karlspreis mit der Aufschrift „Europa – eine Gesellschaft der Werte“ an Papst Franziskus verliehen. In seiner Dankesrede nahm Franziskus ausführlich Stellung zur Frage der Werte, die die europäische Identität ausmachen. Europa – so führte der Papst aus – „lernte es, die verschiedensten Kulturen, ohne sichtliche Verbindung untereinander, in immer neuen Synthesen zu integrieren. Die europäische Identität ist und war immer eine dynamische und multikulturelle Identität.“ Dass die höchste Autorität des kirchlichen Lehramtes sich positiv zum Multikulturalismus und seiner Dynamik äußert, dass sie darin weniger eine Gefahr als vielmehr eine Chance sieht, lässt aufhorchen. Man kann die Position des Papstes zusammenfassen in einer dritten These:
These 3:
Die „Leitkultur“ des Abendlandes war stets die Integration des Verschiedenen.
Die Frucht dieser Integrationsanstrengung ist eine „Einheit in Vielfalt“. Dabei blickt Franziskus nicht nur in die Vergangenheit zurück, sondern konstatiert auch für die Gegenwart, dass nicht das Einfrieren einer einmal erreichten kulturellen Gemeinsamkeit kennzeichnend für Europa ist, sondern die aus der Vielheit und Buntheit sich ergebende Dynamik. Gerade heute, so fährt der Papst in seiner Ansprache fort, in einer Zeit der Krise, geht es darum, „die Größe der europäischen Seele wiederzuentdecken, die aus der Begegnung von Zivilisationen und Völkern entstanden ist, die viel weiter als die gegenwärtigen Grenzen der Europäischen Union geht und berufen ist, zum Vorbild für neue Synthesen und des Dialogs zu werden“. Zwei Dinge schreibt Franziskus den Europäern ins Stammbuch, die sich aus ihrer geschichtlichen Verantwortung ergeben: den Dialog mit jenen Kulturen, die nicht (noch nicht?) zur traditionellen abendländischen Wertegemeinschaft gehören, und den Mut zu neuen, noch nicht gewagten Synthesen und Integrationsanstrengungen.
Hier ist nichts von Verzagtheit oder Ängstlichkeit zu spüren, dass die historischen Sinnerfahrungen Europas nicht auch anderen kulturellen Gruppen kommuniziert werden könnten. Im Gegenteil: Franziskus geht davon aus, dass gerade diese Erfahrungen und der sich auf ihrer Grundlage gebildete Wertehorizont für „die anderen“ hochattraktiv sind. Wer sich der eigenen religiösen und kulturellen Wurzeln gewiss ist, der kann authentisch für sie einstehen. Wenn Europa sich treu bleibt, wird es auch in Zukunft vielfältige kulturelle Traditionen integrieren können, ohne seine eigene Identität preiszugeben.