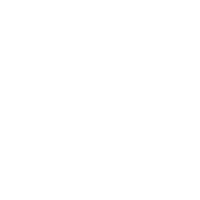Nachrichten
Zu den veränderten Bedingungen von (Un-)Glauben – Beobachtungen und Perspektiven
Zu den veränderten Bedingungen von (Un-)Glauben – Beobachtungen und Perspektiven
Prof. Dr. Veronika Hoffmann, Siegen
DOWNLOAD: PDF-Version
11. März 2016
1. Einleitung: „Noch glauben“ und „nicht mehr glauben“?
- „Glauben Sie an Gott?“
- These: Die Fragestellung ist irreführend
- Die Bedingungen für alle Formen von Glauben oder Nichtglauben haben sich geändert
- (Im Folgenden Anlehnung an: Charles Taylor, Ein säkulares Zeitalter, Frankfurt/M. 2009)
2. Beobachtung 1: „Säkularität“
- „Säkularität“: geänderte Bedingungen des Glaubens
- „Entzauberung“ der Welt
- Folgen
- Drei Anschlussfragen
3. Beobachtung 2: „Authentizität“
- „Kultur der Authentizität“: „Jeder von uns hat seine eigene, originelle Weise des Menschseins.“
- Ich gebe der Welt eine Deutung; das ist nicht die einzig mögliche, aber sie ist engstens mit meiner Identität verknüpft. (Verbindung von „Säkularität“ und „Authentizität“)
- Meine Religiosität muss zu meiner Weise des Menschseins passen: „persönliche Resonanz“
- Rückfrage: Wellnessreligion?
- Echte Authentizität: „persönliche Resonanz“ im Blick auf ein solches Ideal, das „größer“ ist als ich
4. Perspektiven
- 1. „Immer weniger Menschen glauben an Gott“ ist keine Perspektive.
- 2. Glaube als Möglichkeit
- 3. Anspruchsvolles Christsein
- 4. „Persönliche Resonanz“
- 5. Christsein geht nicht in „Einheitsgröße“
- 6. „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.“ (Joh 10,10)
1. Einleitung: „Noch glauben“ und „nicht mehr glauben“?
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
es gibt inzwischen ziemlich viele von ihnen, und die eine oder andere ist Ihnen sicher auch schon begegnet: Ich spreche von den Umfragen zum Thema „Glauben Sie an Gott?“. Die Ergebnisse solcher Umfragen scheinen vorhersehbar: Immer weniger Menschen glauben heute an Gott – die angebliche „Wiederkehr der Religion“ hat daran bislang nichts geändert. Wohlgemerkt: Das gilt in dieser einfachen Form nur für Westeuropa. Zumindest bei uns scheint es aber so zu sein: Es gibt die Menschen, die noch sind, wie die Menschen früher: Sie glauben an Gott. Und es gibt mehr und mehr Menschen, die nicht mehr so sind wie früher: Sie glauben nicht an Gott.
In kirchlichen Kreisen führt das nicht selten zu dem enttäuschten Gefühl: Früher waren die großen Mehrheiten bei uns, jetzt werden wir zur Minderheit. Eine depressive Folgerung lautet: Wir machen etwas falsch, weil die Menschen nicht mehr zu uns kommen. Alternativ finden Sie auch eine aggressive Folgerung: Die heutige Gesellschaft ist schlecht, weil sie den Wert des Glaubens nicht mehr erkennt.
Ich möchte behaupten, dass diese Umfragen in die Irre führen können. Das heißt natürlich nicht, dass die Zahlen nicht stimmten. Natürlich stimmt das: Wenn man allein die Frage nimmt „Glauben Sie an Gott?“, dann kommt heraus, dass heute weniger Menschen als früher an Gott glauben. Meine Behauptung ist aber: Der Früher-Heute-Vergleich funktioniert nur bedingt, weil „glauben“ „heute“ und „früher“ nicht dasselbe bedeutet. Denn eine Veränderung gibt es nicht nur bei der Zahl derer, die nicht glauben. Die Veränderung ist tiefer gehend und betrifft alle: die Glaubenden und die Nichtglaubenden. Auch wir, die wir heute glauben, glauben anders als die Jünger zur Zeit Jesu oder als eine Bäuerin im Europa des 14. Jahrhunderts. Und das scheint mir manchmal verdeckt zu werden durch die Frage: „Glauben Sie an Gott?“ und die Feststellung: Immer mehr tun es nicht.
Denn das suggeriert ein „Wir und die anderen“: „Wir“ glauben – „noch“. Die „anderen“ glauben „nicht mehr“. „Wir“ stehen gewissermaßen noch da, wo „früher“ die Mehrheit war (wann auch immer genau „früher“ ist). Die „anderen“ haben sich verändert, sind weggegangen, aus der Kirche ausgetreten, haben den Glauben ihren Kindern nicht mehr weitergegeben. Was machen „wir“ jetzt? Uns auch ändern, um für „die anderen“ wieder attraktiv zu werden? Da stehen bleiben, wo wir stehen, weil das einfach der „richtige“ Ort ist, die „anderen“ sind es, die vom richtigen Weg abgewichen sind? Ich vereinfache natürlich extrem, aber schauen Sie einmal, ob Sie dieses Lebensgefühl nicht kennen.
Ich möchte demgegenüber also behaupten: Etwas hat sich für alle verändert. Und diese Veränderungen liegen gewissermaßen noch vor der Frage „Glauben Sie an Gott?“ und werden von ihr deshalb nicht richtig erfasst. Die Frage kommt für diese Beobachtungen gewissermaßen zu spät. Ich will sozusagen „hinter“ sie zurück zu den gemeinsamen Bedingungen, unter denen heute so, anders oder auch nicht geglaubt wird. Und ich behaupte: Es lohnt sich, nach diesen geänderten Bedingungen zu schauen, wenn man die heutige religiöse Landschaft verstehen will.
Wenn ich von „geänderten Bedingungen“ spreche, muss ich nicht nur erklären: geändert in welcher Weise?, sondern auch: geändert im Vergleich zu wann? Ich möchte das unter zwei Stichworten tun: 1. „Säkularität“, 2. „Authentizität“. Ich berufe mich dabei weitgehend auf den kanadischen Philosophen Charles Taylor. Taylor sorgt derzeit mit seinem Buch „Ein säkulares Zeitalter“ (1 Frankfurt am Main 2009.) ziemlich für Furore, und mir haben seine Analysen für manches die Augen geöffnet. Taylors Werk hat in der deutschen Übersetzung 1200 Seiten, betrachten Sie das Folgende also, wenn Sie möchten, als eine Art LeseService: Ich versuche Ihnen die für Sie zentralen Punkte in einigermaßen verdaulichen Happen zu liefern.
Im Folgenden erwartet Sie also: zunächst ein längerer Analyseteil, in dem ich die behaupteten Veränderungen unter den genannten Stichworten „Säkularität“ und „Authentizität“ skizziere. Hier bitte ich Sie um ein wenig Geduld, bis sich die praktische Anwendbarkeit der Überlegungen herausschält. Aber prüfen Sie „unterwegs“ schon einmal, ob Sie das, was ich Ihnen verkaufen will, für sich irgendwo bewahrheiten können: an Ihrem Lebensgefühl, an Begegnungen, die Sie machen, an Dingen, die Sie lesen … Das ist der „Beobachtungs“-Teil. An diesen schließt sich gemäß dem Titel ein „Perspektiven“-Teil an. Hier formuliere ich – nicht mehr angelehnt an Taylor, sondern ganz und gar in eigener Verantwortung – ein paar Konsequenzen, die ich spannend fände. Letztlich ist es natürlich Ihre Aufgabe und auch Ihre Kompetenz, die Überlegungen auf das Thema der Bündniskultur anzuwenden.
2. Beobachtung 1: „Säkularität“
„Säkularität“ ist ein notorisch unklarer Begriff. Häufig wird unter einer „säkularen Gesellschaft“ eine verstanden, in der religiöser Glaube im Rückgang begriffen ist. Man kann „Säkularität“ zweitens noch in einem anderen Sinn verwenden. So sprechen wir von Deutschland als einem „säkularen Staat“. Das heißt: Wir glauben beispielsweise nicht, dass unsere Bundeskanzlerin von Gott eingesetzt ist, sondern wir haben sie gewählt. Und es gibt Religionsunterricht, aber man muss nicht teilnehmen, man kann sich auch abmelden. Diese zweite Bedeutung hat mit der erstgenannten Bedeutung von Säkularität nicht unbedingt etwas zu tun: Ein solcher säkularer Staat kann problemlos hochreligiöse Bürger haben.
Charles Taylor meint mit „Säkularität“ nun wiederum etwas anderes. Die Begriffsverwendung ist etwas ungewöhnlich, weil „säkular“ bei ihm nicht der Gegenbegriff zu „religiös“ ist. Sondern er bezieht den Begriff auf den gemeinsamen Rahmen, in dem sich heute alle Weltanschauungen bewegen. Sie ahnen schon: „Säkularität“ bezeichnet genau das von mir angezielte Gebiet „vor“ der Frage „Glauben Sie an Gott?“. Genau so ist es: „Säkularität“ bedeutet bei Taylor, pointiert gesagt, dass die Bedingungen des Glaubens sich geändert haben. Es geht ihm also weniger um Inhalte oder um Fragen der Abnahme des Glaubens. Taylor beobachtet in seinem Werk im Wesentlichen den Wandel von einer Gesellschaft, in der es so gut wie unmöglich war, nicht in der einen oder anderen Weise an Gott zu glauben, zu einer, in der dieser Glaube eine Möglichkeit unter anderen ist. (2 Zur Differenzierung dieser sehr vereinfachten Darstellung vgl. Taylor, Ein säkulares Zeitalter, 11-48.)
Wenn wir eine Zeitreise in die Zeit Jesu machen, den Bewohnern des Mittelmeerraumes ein Mikrofon unter die Nase halten und sie fragen könnten: „Glauben Sie an Gott?“, dann würden Sie niemanden finden, der „Nein“ sagt. Der Glaube an einen Gott oder mehrere Götter war selbstverständlich, ebenso wie der, dass es Mächte gab, die das Leben beeinflussten: Gestirne, Dämonen, Engel … Wenn Jesus „Glauben“ fordert, will er nicht Atheisten bekehren. Es geht vielmehr darum, sich wirklich mit dem ganzen Leben auf Gott einzulassen, an dessen Existenz man natürlich nicht zweifelt. Und das gilt nicht nur für die Zeit Jesu, es gilt über weite Strecken der europäischen Religionsgeschichte. Man kann auf alle möglichen Weisen glauben, man kann Magie praktizieren, man kann sich um Gott nicht kümmern, die Gebote nicht halten … Aber es gibt keine rein „immanente“ Deutung der Welt; also keine Deutung der Welt, die in sich geschlossen wäre, in der nichts „Transzendentes“ vorkommt, das auf sie einwirkt: kein Gott, keine übernatürlichen Mächte, keine Geister und Engel.
Sie merken natürlich, wenn ich von „Deutungen der Welt“ spreche, dann meine ich mit „Welt“ nicht den Planeten Erde und unser Sonnensystem. Gemeint ist unsere menschliche Welt, in der wir leben: die politischen und gesellschaftlichen Strukturen, unser Verständnis, was es heißt, ein Mensch zu sein, wofür es sich zu leben lohnt etc. Ob Sie auf die Natur schauen, auf die gesellschaftliche Ordnung, auf den Gang der Geschichte oder das eigene Leben: Gott ist bis etwa ins 16. Jahrhundert immer dabei, man kann ihn aus der Welt nicht einfach „abziehen“ und schauen, was übrig bleibt. Gott ist auch nicht einfach „draußen“, er ist mit allem verwoben. Das heißt: Der Glaube an Gott ist nicht eigentlich eine Deutung der Welt, sondern er geht allen Deutungen immer schon als Selbstverständlichkeit voraus. Es ist ein Rahmen, der selbst nicht mehr hinterfragt wird.
Wenn Sie den etwas schrägen Vergleich gestatten: Auch wenn unsere Weltdeutungen heute noch so unterschiedlich sind, gehen wir doch alle davon aus, dass es eine äußere Realität gibt, in der wir uns bewegen. Wir vermuten nicht, dass wir in Wirklichkeit Gehirne sind, die in einer Nährlösung schwimmen und auf irgendeinem Weg zur Illusion einer äußeren Welt angeregt werden. Wir gehen davon so selbstverständlich aus, dass wir es gar nicht thematisieren. Die Alternative, dass wir Gehirne in Nährlösung sind, ist theoretisch vielleicht denkbar: im Kino und in Gedankenspielen der Philosophen. Aber kennen Sie irgendjemanden, der das auch nur im Geringsten für plausibel hält? Das ist das, was Taylor den „Rahmen des Selbstverständlichen“ nennt – einen Rahmen, in dem alle unsere Weltdeutungen stattfinden und über den wir in der Regel nicht noch einmal eigens reflektieren.
Und zu diesem Rahmen gehört lange, dass unsere Welt eben nicht in sich geschlossen ist, sondern eine „verzauberte Welt“, in der es transzendente Kräfte gibt, die auf die Welt und auf uns einwirken. Die Ordnung der Schöpfung, die Ordnung der Gesellschaft, die Ordnung der Familie stammen alle von Gott. Politik und Religion sind gerade nicht getrennt wie im modernen säkularen Staat. Dementsprechend wirkt Gott auch in den militärischen Siegen und Niederlagen. Und er wirkt im Leben des Einzelnen unmittelbar, er schickt Krankheiten, um zu strafen, er ist verantwortlich für das Wetter, das eine gute oder schlechte Ernte beschert. Engel stehen den Menschen hilfreich zur Seite, während man sich der Dämonen erwehren muss. Alles, was man tut, hat Folgen für das jenseitige, das „eigentliche“ Leben. Die Heiligen sind insbesondere in ihren Reliquien anwesend und schützen „ihre“ Kirchen. – An meiner Darstellung merken Sie vermutlich schon, dass ich Ihnen das nicht als die „gute alte Zeit“ verkaufen will, in der noch alle Menschen fromm waren. Da finden sich auch fragwürdige
Dinge, zum Beispiel magische Praktiken, als könnte man mit diesem Gott irgendwie handeln, seiner habhaft werden, als steckte er zum Beispiel in einer Hostie in einer Weise, dass man seine Macht auch für schwarze Magie verwenden könnte … Ganz abgesehen davon, dass man fragen kann, ob es dem Glauben nicht eine neue Qualität gibt, wenn er keine kulturelle Selbstverständlichkeit ist, sondern etwas, das man sich aneignen muss. Ich komme darauf zurück.
Wie kommt es jetzt zur Veränderung dieses „selbstverständlichen Rahmens“? Hier müssten wir eigentlich einen großen kultur- und geistesgeschichtlichen Bogen schlagen. Wir müssten über Konfessionskriege und die Aufklärung, neue politische Theorien, die aufkommende Geschichtswissenschaft und die ebenso aufkommenden Naturwissenschaften sprechen. Das kann ich hier natürlich nicht. Ich greife einen einzigen Baustein dieser Entwicklung als Beispiel heraus:
Meine Schilderung der „verzauberten Welt“ eben hat Ihnen vielleicht schon deutlich gemacht, warum man mindestens auf der biblisch-christlichen Linie immer wieder darum gekämpft hat, dass die Gottheit Gottes gewahrt bleibt: Gott mag sich der Welt zuwenden, in ihr antreffbar sein, sie erschaffen und erhalten. Aber er ist nicht einfach Teil der Welt. Gott ist im Himmel und wir sind auf der Erde, betont schon das Alte Testament, und auch das Bilderverbot unterstreicht Gottes Andersheit und Unverfügbarkeit. Man kann diesen Gott nicht dingfest machen, seine Anwesenheit nicht erzwingen, ihn nicht bestechen, damit er tut, was man sich wünscht. Dieser Kampf um die Gottheit Gottes wird immer wieder geführt. Wir führen ihn bis heute in der religiösen Bildungsarbeit, und zu Recht.
Historisch gesehen hatte das allerdings unbeabsichtigte Folgen. Sehr vereinfacht gesagt: (3 Die in Wirklichkeit erheblich komplexere Entwicklung skizziert Taylor in Teil II von „Ein säkulares Zeitalter“.) Im Kampf gegen eine Vermischung von Gott und Welt kam es zu einer immer schärferen Trennung von Gott und Welt. Dieser Gott im Himmel rückte immer weiter weg, und die Erde gehörte allein den Menschen. Gott hatte vielleicht noch die Welt erschaffen und ihr eine Ordnung gegeben, aber er griff in diese Ordnung nicht mehr ein. Er kümmerte sich auch nicht mehr persönlich um jeden Einzelnen. Ebenso wurde die gesellschaftliche Ordnung zu einer Sache nicht „von Gottes Gnaden“, sondern der menschlichen Übereinkunft. Aber was unterscheidet schließlich einen Gott, der weit weg ist und so göttlich, dass er sich an der Erde die Hände nicht schmutzig macht, von einem Gott, den es nicht gibt? Die Grenze zwischen der Welt und dem Bereich Gottes ist undurchdringlich geworden. Zum ersten Mal kann man eine Welt denken, die ganz ohne Transzendenz auskommt, ohne „übernatürliche Mächte“.
Das ist, wie gesagt, nur eine der vielen Linien, die Taylor auszieht, um die große Veränderung der Säkularität deutlich zu machen. Und Geschichte verläuft auch nicht einfach geradlinig. Aber alles in allem führt das zu dem, was Max Weber Anfang des 20. Jahrhunderts als „Entzauberung der Welt“ beschreibt. Der „selbstverständliche Rahmen“ ist jetzt nicht mehr einer, in der überweltliche Kräfte, zum Beispiel das Wirken Gottes, immer schon mitgedacht wären. Sondern der selbstverständliche Rahmen ist jetzt ein immanenter. Man kann weiterhin davon ausgehen, dass die Welt gewissermaßen „nach oben offen“ ist, dass es einen Gott gibt, der sie gewollt hat und auf sie schaut. Aber man muss es nicht mehr. Man kann die Welt auch ganz und gar aus sich selbst erklären. Das heißt: Es entsteht zum ersten Mal nicht nur für einige wenige Philosophen, sondern für die breite Masse der Menschen die Möglichkeit des Unglaubens. Und damit wird auch der Glaube von einer Selbstverständlichkeit zu einer Möglichkeit: einer Möglichkeit unter anderen, die Welt zu verstehen.
Aber damit ist die Pointe noch nicht ganz erfasst. Vielmehr muss man sagen: Wir leben in einer Welt, in der jede Deutung eben das ist: eine Deutung, zu der es Alternativen gibt. Jedes Weltverständnis ist eine Möglichkeit – und es gibt immer auch andere Deutungsmöglichkeiten, es gibt Irritationen meiner Deutungen durch die Weise, wie andere leben. Andere Menschen, die sich weder als verblendet noch als böse disqualifizieren lassen, leben aus anderen Überzeugungen. Glaube ist Deutung – und anderer Glaube oder Unglaube ist es auch.
Deswegen geht es nicht nur darum, festzustellen: Atheismus gibt es in nennenswertem Umfang erst in der Neuzeit. Das sagt uns schon die Umfrage: „Glauben Sie an Gott?“ Es geht um die Veränderung, die sich für alle ergibt, weil jetzt jede Weise, die Welt zu verstehen, eine Deutung ist. Werfen wir deshalb noch einen genaueren Blick auf das, was „vor“ der Frage „Glauben Sie an Gott?“ liegt. Das heißt: Warum es heute nicht nur die Möglichkeit gibt, diese Frage mit „Nein“ zu beantworten, sondern inwiefern auch die Antwort „Ja“ heute eine andere ist. Dazu stelle ich drei Rückfragen an das bisher Gesagte:
1. Heißt das, wir müssen uns heute für unseren Glauben entscheiden, was man früher nicht musste? Die eigene Entscheidung spielt wohl eine größere Rolle. Jedenfalls ist der Glaube in stärkerem Maß etwas, das mich betrifft – ich komme gleich unter dem Stichwort der „Authentizität“ darauf zurück. Aber zum einen gab es auch früher die Komponente der Entscheidung. Als Glaube Teil der Kultur war, gab es genug, die einfach mitgelaufen sind. Glaube als wirklich persönlich gelebter, der die ganze Person prägt, als Nachfolge Christi, war schon immer auch eine Sache der Entscheidung.
Und heute wie früher muss ich mich nicht entscheiden. Es gibt Entscheidungen, um die ich kaum herumkomme, zum Beispiel, was ich demnächst esse. Aber in Sachen Religion kann ich es auch einfach auf sich beruhen lassen und mich nicht darum kümmern. Das heißt dann nicht: Ich glaube nicht, sondern eben: Ich kümmere mich nicht darum. Es spielt für mich keine Rolle. Der Unterschied zwischen „früher“ und heute, also zwischen einem Christentum, das in die Gesellschaft und Kultur untrennbar hineinverwoben war, und dem heutigen Zustand der Säkularität wäre, vereinfacht gesagt, eher der: Früher sind die Indifferenten vielleicht in die Sonntagsmesse gegangen, jedenfalls waren sie getauft, das war eben so. Heute sind sie in Westdeutschland vielleicht getauft, in Ostdeutschland nicht, und in die Kirche gehen sie wahrscheinlich nicht, vielleicht an Weihnachten.
2. Heißt die Rede von der „Möglichkeit“ des Glaubens, dass wir mehr oder weniger nach Lust und Laune wählen, was wir glauben wollen? Das ist tatsächlich nicht gemeint. Es geht hier um etwas tiefer Liegendes. Wir sprachen gerade von der Entscheidungskomponente in Sachen Glauben. Die ist sicher wichtig, aber es ist nicht die einzige Komponente, vielleicht noch nicht einmal die zentrale. Denn man kann nicht einfach beschließen zu glauben oder nicht zu glauben, wie man beschließt, an die Ostsee oder ans Mittelmeer in Urlaub zu fahren. Könnten Sie beschließen, ab heute, 16 Uhr, nicht mehr zu glauben? Glaube entsteht aus Erfahrungen, Zeugnissen, Gesprächen, Argumenten, Praktiken … Das wissen Sie alle, deshalb machen Sie ja Ihre Schönstattarbeit. Natürlich kommt dabei immer wieder die Entscheidung ins Spiel: Wenn ich durch eine jahrzehntelange Praxis von Gebet und Partikularexamen in meinem Charakter geprägt bin, dann hat das auch mit dem täglichen Entschluss zu solchen Praktiken zu tun. Und natürlich gibt es die Entscheidung, das Liebesbündnis zu schließen, dem Ruf in die Ehelosigkeit zu folgen, mich dem Familienbund anzuschließen etc. Aber speisen sich nicht alle diese Entschlüsse, selbst wenn man ihnen ein Datum geben kann und wenn man sie vielleicht sehr bewusst getroffen hat, aus tieferen Quellen? Und das kann auch kaum anders sein. Denn jedes Mal geht es um mich als ganze Person, um meine Identität, die ich nicht einfach machen und mir zurechtlegen kann. Dazu muss ich wohl gar nicht mehr sagen, der Gedanke ist schließlich in Kentenichs ganzer Pädagogik zentral angelegt.
3. Folgt aus dem Gesagten, dass man heute nur noch unsicher glauben kann? Die These gibt es, aber ich halte sie für falsch. Der Religionssoziologe Peter Berger geht zum Beispiel davon aus, dass man unter den skizzierten Bedingungen sich seines Glaubens nicht mehr fraglos sicher sein kann – außer man verbarrikadiert sich fundamentalistisch und erklärt, dass eben doch alle dumm oder böse sind, die etwas anderes glauben. ( 4 Vgl. Peter L. Berger und Anton Zijderveld: Lob des Zweifels. Was ein überzeugender Glaube braucht, Freiburg 2010.) Meines Erachtens kommt es darauf an, was man unter „Glaubensgewissheit“ versteht. Das mag heute etwas anderes sein als früher. Aber sie ist nicht unmöglich.
Man kann das zum einen auf der Ebene der Überzeugungen sagen: Wir können uns in Werten und anderen Grundüberzeugungen durchaus gewiss sein, auch wenn wir wissen, dass es auch andere Überzeugungen gibt. Wäre ich in Saudi-Arabien geboren, fände ich es vielleicht richtig, wenn Frauen nicht Auto fahren. Insofern ist meine Überzeugung, dass Frauen das Autofahren erlaubt sein sollte, kontingent. Wären die Umstände anders, wäre sie vielleicht auch anders. Dennoch bin ich der Meinung, dass meine Überzeugung kein reiner Zufall ist, nur weil ich eben in Deutschland aufgewachsen bin. Und ich bin mir meiner Position auch durchaus sicher. Schon auf der Ebene der Überzeugung kann ich mir also sicher sein, auch wenn ich sehe, dass und warum andere anderer Meinung sind.
Zum Zweiten gilt: Glauben ist nun noch weit mehr als eine bestimmte theoretische Überzeugung. Es ist eine Grundhaltung meines Lebens, die mein Verständnis der Welt, aber auch mein Handeln, meine Praxis beeinflusst, mich in eine Gottesbeziehung führt etc. Hier scheint mir für die Frage der Gewissheit heute die entscheidende Rolle zu spielen, dass mein Glaube und meine Praxis von mir gedeckt sind – ich komme auf diese Figur gleich ausführlicher zurück. Das heißt: Meine Lebenserfahrungen, meine Weltinterpretation, meine Argumente sind es, die mich zu einer Gewissheit im Glauben führen können. (5 Vgl. Hans Joas: Braucht der Mensch Religion? Über Erfahrungen der Selbsttranszendenz, Freiburg 2004; ders.: Glaube als Option. Zukunftsmöglichkeiten des Christentums, Freiburg 2012.)
In der Regel ist das wohl eine Gewissheit, die sich „auf dem Weg“ bewahrheitet. Vielleicht haben wir auch Erfahrungen gemacht, die uns von einem Augenblick auf den anderen umgekrempelt haben. Aber wie viel Gewissheit gäben solche Erfahrungen, wenn sie allein stünden? Religionspsychologisch spricht man vom Problem des „Morgens danach“: Wie sieht meine Erfahrung am nächsten Morgen, im Rückblick aus?, nach religiöser Überspanntheit? Nachtanbetung am Ende von Exerzitien, da kann man schon mal aus der Rolle fallen? Oder prägt diese Erfahrung sich in mein Leben ein und wandelt es nach und nach wirklich um? Deshalb zielt die schönstättische Pädagogik ja weniger auf einmalige Gipfelerfahrungen, als auf die Frage, was es ganz konkret und alltäglich heißt, das Liebesbündnis zu leben. Ich deute damit mein Leben und meine Welt unter einer bestimmten Perspektive, ich lebe nach ihr und ich merke: Das passt, das ist stimmig, das führt mich in eine größere Fülle. Diese Form von Glaubensgewissheit ist uns meiner Meinung nach auch heute durchaus zugänglich. Aber sie merken, dass diese Gewissheit nicht heißt: „Es kann gar nicht anders sein als so.“
3. Beobachtung 2: „Authentizität“
Damit komme ich zu meinem zweiten Stichwort: „Authentizität“. Taylor spricht von einer „Kultur der Authentizität“, die zunächst im Kontext der Romantik entsteht. Seit den 1960er Jahren ist sie zum Teil unserer Massenkultur geworden. ( 6 Vgl. zum Folgenden: Teil III und IV von „Ein säkulares Zeitalter“ sowie die leichter zugängliche Fassung in: Charles Taylor, Das Unbehagen an der Moderne, Frankfurt am Main 1995.) Für diese „Kultur der Authentizität“ ist die Idee wesentlich, dass „jeder von uns seine eigene originelle Weise des Menschseins hat“( 7 Taylor, Unbehagen, 38.). Natürlich hat man schon immer Unterschiede zwischen Menschen wahrgenommen, aber diese Unterschiede wurden nicht in derselben Weise qualifiziert. Erst jetzt kommt ihnen zentrale Bedeutung zu. Taylor formuliert gewissermaßen als Leitsatz dieser Kultur: „Wenn ich mir nicht treu bleibe, verfehle ich den Sinn meines Lebens; mir entgeht, was das Menschsein für mich bedeutet.“ (8 Ebenda. Hervorhebung im Original.)
Man kann sich diese fundamentale Veränderung unter anderem an den Veränderungen im Verständnis der Kunst verdeutlichen. Zum Teil wird der Künstler jetzt überhaupt erst als ein solcher in unserem Verständnis des Wortes betrachtet. So wird an der Wende zum 19. Jahrhundert der Komponist von einem „Tonsetzer“, dem Handwerker der Musik, zum „Tondichter“ aufgewertet.
Im Blick auf Religion bedeutet diese „Kultur der Authentizität“: Meine religiöse Auffassung muss mir etwas sagen. Sie muss zu mir passen, sie gehört zu meinem Selbstausdruck, sie spiegelt mein ureigenstes Verständnis der Welt. Vorrangig ist deshalb nicht die Vorgabe einer Autorität oder einer Tradition, sondern der je eigene spirituelle Weg. Dieser Weg bleibt natürlich geprägt durch Erziehung, durch die religiösen Möglichkeiten, die das Umfeld bietet, etc. Aber etwas zu glauben, einfach weil es die Kirche vorgibt, ohne dass es für einen selbst irgendeine Bedeutung hat: Das wird zunehmend unplausibel. Wohlgemerkt: Taylor heißt dieses Ideal einer „Kultur der Authentizität“ nicht einfach pauschal gut. Ich komme gleich darauf zurück. Aber um eine Bezugnahme auf dieses Ideal kommen wir seines Erachtens nicht herum, weil wir hinter dieses Ideal gar nicht zurück können: Es gibt keinen Rückweg in eine Welt selbstverständlicher Ordnungen, in der das eigene Weltverständnis sich schlicht auf einen allgemein geteilten Deutungshorizont beziehen konnte.
Ich komme gar nicht umhin, der Welt eine – meine – Deutung zu geben, wohl wissend, dass es nicht die einzig mögliche ist. Und so ist es nahe liegend oder vielleicht sogar zwingend, dass diese Deutung engstens mit meiner Selbstdeutung, mit meiner Identität verknüpft ist. Entscheidend ist also die „persönliche Resonanz“: Was bedeutet das für mich? (9 Taylor spricht von der Notwendigkeit von „Sprachen der persönlichen Resonanz“: Unbehagen, 102.)
Nun mag sich das nach einer Art Wellnessreligiosität anhören: Meine persönliche Resonanz könnte sich ja zum Beispiel bei Schutzengeln und angenehmen religiösen Erfahrungen einstellen, nicht aber bei der Forderung nach Kreuzesnachfolge. Ich sagte bereits, dass in Taylors Augen diese Kultur der Authentizität nicht einfach unkritisch gutzuheißen ist. Solche trivialen Formen von Religiosität gibt es natürlich. Wie sieht religiöse Authentizität aus, wenn sie nicht trivial ist?
Problematisch verkürzt wird die Idee der Authentizität, wenn es einfach darum geht, dass ich wähle: Es ist nicht wichtig, was ich wähle, sondern allein, dass ich wähle. Auf den ersten Blick scheint das gut zur Idee der persönlichen Resonanz zu passen. Auf den zweiten Blick ist das aber ein Fehlschluss. Denn wenn der Inhalt der Wahlalternativen irrelevant ist, dann verliert auch die Wahl ihre Bedeutung. Sie wird so trivial wie die Wahl der Lieblingsfarbe. Wenn mein Leben nicht völlig banal werden soll, trägt das nicht. Ein Ideal wird nicht dadurch zu einem Ideal, dass wir es wählen. Werte erhalten ihre Bedeutung nicht durch unsere Wahl, sondern umgekehrt muss unsere Wahl sich in einen größeren Kontext stellen. In den Worten Taylors: „Wer als Handelnder im Leben nach etwas Bedeutsamem strebt und den Versuch macht, zu einer sinnvollen Selbstdefinition zu gelangen, muss sein Dasein vor einem Horizont wichtiger Fragen führen. ... Nur wenn ich in einer Welt lebe, in der die Geschichte, die Forderungen der Natur, die Bedürfnisse meiner Mitmenschen, die Pflichten des Staatsbürgers, der Ruf Gottes oder sonst etwas von ähnlichem Rang eine ausschlaggebende Rolle spielt, kann ich die eigene Identität in einer Weise definieren, die nicht trivial ist.“( 10 Taylor, Unbehagen, 51.)
Im Bild gesprochen: Wer das, wonach er strebt, allein an sich selbst festmacht, ist wie der berühmte Baron Münchhausen, der sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen versucht. Damit wir uns nicht völlig in uns selbst drehen und dabei bei einem kleinen, trivialen, egozentrischen Leben landen, brauchen wir eine Verankerung „außerhalb“. Man könnte hier auch an Luthers berühmtes Bild vom Sünder als „in sich selbst verkrümmtem Menschen“ denken. Damit ist theologisch natürlich eine noch weiter gehende Aussage verbunden. Aber auch für diesen Zusammenhang finde ich das Bild sehr sprechend: Mein Lebensideal kann ich nicht allein an mir und meiner Wahl festmachen, will ich mich nicht in mich selbst verkrümmen – und damit gerade das Leben verfehlen, nach dem ich doch so sehr suche.
„Kultur der Authentizität“ soll also nicht heißen: Ich kümmere mich nur noch um mich. Wir sollen durchaus nach etwas suchen, was über uns hinausgeht – aber das als Ideal anzunehmen, muss „durch mich hindurch“. So hat ein Leben nach den evangelischen Räten beispielsweise sicher wenig mit Selbstverwirklichung in einem trivialen Sinn zu tun. Aber es kann mein authentisches Leben sein – jedoch nicht, weil ich abstrakt erkannt habe, dass das eine gute Form des Christseins wäre, sondern weil ich es als mein Ideal erfahren habe. Ich vermute auch, dass die meisten von Ihnen als Persönliches Ideal keine Zeile aus dem Glaubensbekenntnis gewählt haben. Das wird nicht heißen, dass das Glaubensbekenntnis Ihnen nicht wichtig wäre. Aber es ist nicht das, was bei Ihnen die innerste persönliche Resonanz erzeugt. („Mein Schönstatt“, könnten Sie übersetzen – ich weiß nicht, wie verbreitet das Schlagwort noch ist.)
Halten wir einen Moment inne, bevor wir von den „Beobachtungen“ zu den „Perspektiven“ wechseln. Wir haben „Säkularität“ und „Authentizität“ als zwei Grundaspekte betrachtet, die zumindest für Europa etwas von einem allgemein geteilten Lebensgefühl einfangen, einer zeitgenössischen „Kultur“, wenn Sie das Wort in einem weiten Sinn verstehen wollen. Das heißt, es geht um Dinge, die nicht immer ausdrücklich formuliert werden, sondern die eher als ein weithin geteiltes Grundverständnis mitlaufen.
– „Säkularität“: Ob man glaubt und was man glaubt, es geschieht immer in dem Bewusstsein, dass das nicht die einzig mögliche Sicht auf die Welt ist. Was früher den allgemein geteilten Rahmen des Weltverständnisses bildete, ist jetzt grundsätzlich bezweifelbar und damit Teil des Streits um die angemessene Deutung der Wirklichkeit.
– „Authentizität“: In diesem Streit treibt uns nicht allein die Frage um, was denn wohl „richtig“ ist, sondern die Frage, welches Verständnis mich ausmacht, wie ich leben kann, welche Weise, in der Welt zu leben und sie zu verstehen, bei mir zu einer „persönlichen Resonanz“ führt.
In diesen Punkten sind Glaubende und Nichtglaubende aller Sorten Zeitgenossen: Das ist der gemeinsame Rahmen, in dem wir alle stehen und in dem die jeweilige Position verständlich gemacht und gelebt werden muss, aber auch verständlich gemacht und gelebt werden kann.
4. Perspektiven
Was ergeben sich aus diesen Beobachtungen für Perspektiven? Ich möchte Ihnen abschließend sechs anbieten:
1. „Immer weniger Menschen glauben an Gott“ ist keine Perspektive. Die Aussage ist für wesentliche Teile Europas nicht falsch, aber, wie ich versucht habe zu zeigen, wenig hilfreich. Denn sie verleitet eher zu falschen Folgerungen. Ich jedenfalls trauere der „guten alten Zeit“ nicht hinterher, wenn das heißen soll, dass „man“ in der Kirchenbank saß, weil „man“ das so machte. Das soll natürlich keine Pauschalverurteilung früherer Gläubiger sein. Aber ich wäre vorsichtig, mich in Zeiten zurückzusehnen, wo das Christentum „kulturgestützter“ war als heute. Eine „christliche Kultur“ kann auch eine Mitläufer-, gar eine Zwangskultur sein.
2. Glaube als Möglichkeit Die Unselbstverständlichkeit jeder Weise zu leben begleitet uns. Man könnte immer auch anders leben, anders glauben, anders lieben, es anders machen. Deshalb dürfte Glaubensgewissheit mehr denn je eine „Gewissheit auf dem Weg“ werden: In meinem Leben bewährt sich nach und nach, was ich glaube, wie ich meine Gottesbeziehung lebe und wie sie mein Leben formt. Und vielleicht ist zumindest für viele von uns der Zweifel ein Zeitgenosse, der uns immer wieder herausfordert, für uns selbst zu klären: Wo stehe ich und warum stehe ich hier? Man kann das als Glaubensschwäche oder als Bedrohung lesen, aber vielleicht auch einfach als Anerkenntnis, voll und ganz in der Säkularität zu leben.
3. Vielleicht ist Christsein anspruchsvoller geworden. Es braucht mehr wirklich eigene Praxis, mehr eigene Erfahrung, mehr eigene Reflexion, wer ich bin, wo ich stehe, was der Glaube für mich bedeutet. Es braucht sozusagen mehr „religiöse Kompetenz“, wenn Sie „Kompetenz“ in einem umfassenden, nicht nur theoretischen Sinn nehmen. Ein solches „anspruchsvolles christliches Leben“ zu unterstützen, scheint mir gerade eine mögliche Zielbeschreibung Schönstatts zu sein.
4. Anspruchsvoll, aber auch erfüllend wäre ein solches christliches Leben, weil es um Authentizität geht. Leben aus dem Glauben kann sich nicht mehr darin erschöpfen, dass ich nachspreche, was andere mir vorsprechen, und mitmache, was andere machen. Es muss mein Glaube sein, er muss eine Gestalt haben, die zu mir passt, in der sich mein Selbst entfalten kann. Nur dann, wenn er zu mir „passt“, kann er mich umgekehrt prägen. So wird er gewissermaßen zu meiner persönlichen Lebensform. Vielleicht lässt sich die Taylorsche Idee der „Authentizität“ mit der Kentenichschen vom „Persönlichen Ideal“ reformulieren – nämlich dann, wenn Sie das Persönliche Ideal wirklich radikal denken, nicht als meinen frommen Lieblingsgedanken, sondern als das, was ich als meinen innersten Kern und zugleich meine tiefste Sehnsucht erlebe. Das wäre da, wo meine „persönliche Resonanz“ am stärksten ist und sagt: So will ich leben, das ist der tiefste Ausdruck dessen, wer ich bin.
5. Es gibt kein Christsein in „Einheitsgröße“ mehr. An dieser Stelle haben wir kirchlich im Moment ein bisschen Umgangsschwierigkeiten, denn die offizielle Struktur ist, überspitzt gesagt: „rein oder raus“. „Rein“ heißt: getauft werden. Und dann gilt das komplette Programm: das ganze Glaubensbekenntnis, die Lehre der Kirche in allen Dimensionen, Sonntagsgottesdienst, Osterbeichte etc. „Teilidentifikationen“ sind gewissermaßen nicht vorgesehen. Sie werden aus kirchlicher Sicht vielmehr als Defizit gelesen und führen damit zu Konflikten. – Hinter dieser allzu flotten Bemerkung stecken natürlich Fragen, die viel differenzierter angegangen werden müssten. Das will ich hier nicht tun, ich will nur pauschal fragen: Bräuchten wir nicht angesichts dessen, was ich skizziert habe, mehr Möglichkeiten, solche individuellen Formen von Religiosität positiv zu lesen und zu integrieren? Wo wir kirchlich noch nach Modellen suchen, „gestufte Mitgliedschaft“, „Sympathisanten“ und Ähnliches in positiver Gestalt zu denken, scheint mir das in der Struktur der Schönstatt-Bewegung deutlicher angelegt: nicht „rein oder raus“, sondern eben eine Vielfalt von Bindungs- und Identifikationsformen. Wenn es gut geht, heißt es deshalb nicht: Wie muss man sein, um Schönstätter zu sein? Was sagt der Gründer dazu? Sondern: Was ist mein Schönstatt? Wo liegt für mich die „persönliche Resonanz“? Wie und wo werde ich durch Schönstatt mehr zu dem Menschen, der ich sein will und von dem ich glaube, dass Gott mich so gedacht hat?
6. „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.“ (Joh 10,10) Ein letztes Mal zurück zu Taylor: Sie merken, zumindest in meiner Lesart von ihm geht es sehr stark darum, dass Menschen fragen, wie sie leben können. Taylor spricht von der Suche nach der „Fülle“: der Erfahrung von Ganzheit, von Sinn, davon, dass das Leben eine Richtung, eine Mitte hat. ( 11 Vgl. Ein säkulares Zeitalter, 16-45.) Als Beschreibung für das, was ich selbst auf meinem Glaubensweg suche und wobei ich anderen helfen möchte, finde ich das Stichwort sehr hilfreich und biete es Ihnen deshalb abschließend an: Wir alle suchen nach dem Leben in Fülle. Die Veränderungen, die ich Ihnen unter „Säkularität“ skizziert habe, heißen dann: Man kann sich in unserem Zeitalter zum ersten Mal eine „Fülle“ denken, die rein innerweltlich bleibt, ein Leben, das rund und gut ist, ohne dass es Gott zum Urgrund und zum Ziel hat. Und „Authentizität“ heißt: Wir nehmen heute die Antwort auf die Frage nach der „Fülle“ für unser Leben nicht mehr einfach von einer Tradition oder einer Autorität entgegen: So musst du leben, dann geht es gut. Sondern wir suchen nach unserer eigenen Antwort. Das heißt aber auch: Für Sucher nach der Fülle sind heute weniger die großen Lehrsysteme interessant. Interessant sind vielmehr Menschen, deren Leben leuchtet, weil sie für sich diese Fülle gefunden haben. Das bedeutet dann noch nicht, dass deren Weg genau auch meiner ist. In Zeiten von Authentizität wäre es ein Kurzschluss zu meinen, wenn ich etwas überzeugend vorlebe, fangen andere an, es nachzumachen. Vielmehr werden sie möglicherweise angeregt, nach ihrer Fülle zu suchen, und vielleicht fragen sie auch nach Begleitung auf diesem Weg.
Ich lese das Anliegen von Papst Franziskus mit dem „Jahr der Barmherzigkeit“ genau so: Es geht darum, dass wir leben können, und das nicht klein, ängstlich, schuldbeladen, eingesperrt in unsere Vergangenheit, sondern aus der Fülle des Erbarmens Gottes. Und natürlich sind wir mit der Sehnsucht nach der Fülle mitten im Evangelium und bei dem, der von sich sagt: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.“ (Joh 10,10)