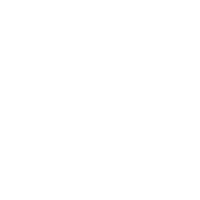Woran erkennt man eigentlich gute historische Forschung?
Der Umgang mit historischen Quellen und mit Geschichte überhaupt kann vielfältig sein: Quellen und Dokumente können dazu dienen, die eigene Weltanschauung mit scheinbar objektiven Belegen abzustützen, sie können benutzt werden, um mit reißerischen Thesen Aufmerksamkeit zu erringen oder eine politische Agenda zu verfolgen, man kann sie auch um ihrer selbst willen studieren, um möglichst unvoreingenommen herauszubekommen, „wie es wirklich war“. Nur die letzte Haltung ist im vollumfänglichen Sinn wissenschaftlich, wenn Wissenschaft eine Verpflichtung auf Erkenntnis von Wahrheit in all ihrer Differenziertheit und Multiperspektivität meint. Die Absicherung der eigenen Weltanschauung tendiert dazu, aus dem vielschichten historischen Material das auszuwählen, was am besten in das vorgefasste Konzept passt, und anderes gar nicht erst zu berücksichtigen. Auch das handlungsleitende Interesse an Aufmerksamkeit oder an strategischen Diskursen wählt die Dokumente aus, die zur Erreichung des Ziels am geeignetsten erscheinen, und unterdrückt andere, gegenläufige. Dem Ideal, zu verstehen „wie es wirklich war“, sich anzunähern, gelingt hingegen nur, wenn tatsächlich alle erreichbaren Quellen „zum Sprudeln“ gebracht werden. Und selbst dann bedarf es noch einiger zusätzlicher Qualitätskriterien, wie die Geschichte der geschichtlichen Forschung zeigt.
Kritische Quellenbeurteilung
Herodot von Halikarnassos, ein griechischer Schriftsteller des 5. Jahrhunderts vor Christus, gilt als „Vater der Geschichtsschreibung“ (Cicero: De legibus I 5). Die traditionelle Ansicht geht davon aus, dass er mehrere weitläufige Reisen unternommen und dabei so etwas wie Quellenforschung betrieben hat. Zumindest behauptet er das in seinem neun-bändigen Werk „Historien“. Trotz dieses Anspruchs hat Herodot bisweilen ein auffallend unkritisches Verhältnis zu seinen Quellen und Gewährsleuten. So berichtet er im dritten Buch der „Historien“ etwa von indischen Ameisen, die „nicht so groß wie Hunde, aber größer als Füchse“ seien und goldhaltigen Sand aus dem Innern der Erde zu Tage förderten (Historien III, 102), oder von arabischen Schafen, deren Schwänze „mindestens drei Ellen lang sind“, sodass die Hirten, um das Wundscheuern der Schwänze zu vermeiden, sie auf Wägelchen binden, die die Schafe hinter sich herziehen (Historien III, 113). Schon in der Antike hat man sich an diesen phantasievollen Berichten gestoßen, die zwar reißerisch sind, aber kein glaubwürdiges Bild der echten Verhältnisse zeichnen.
Deshalb mag Herodot zwar Geschichte und Geschichten niedergeschrieben haben, ein genau arbeitender und kritisch prüfender Historiker ist er aber wohl eher nicht gewesen. Das nimmt erst eine Generation später Thukydides beim Verfassen der Geschichte des Peloponnesischen Krieges für sich in Anspruch, wenn er sich erkennbar von der Vorgehensweise Herodots distanziert: „Was aber tatsächlich geschah in dem Krieg, erlaubte ich mir nicht nach Auskünften des Erstbesten aufzuschreiben, auch nicht ‚nach meinem Dafürhalten‘“ – eine Wendung, die Herodot immer wieder gebrauchte – „sondern ich bin Selbsterlebtem und Nachrichten von andern mit aller erreichbaren Genauigkeit (akribeia) bis ins Einzelne nachgegangen“ (Thukydides I, 22). Es ist die größtmögliche Genauigkeit, die Akribie, die einen Historiker von einem bloßen Geschichtenerzähler unterscheidet. Gute historische Forschung verlässt sich nicht einfach auf Aussagen, sondern sie prüft sorgfältig ihre Quellen, indem sie allen erreichbaren Einzelheiten auf den Grund geht.
Unvoreingenommene Sachlichkeit
Als zweites Prinzip guter historischer Forschung nennt Tacitus zu Beginn seines Geschichtswerks über die frühe Römische Kaiserzeit (die sog. „Annalen“) die moralische Unvoreingenommenheit: „Die Taten des Tiberius und Caligula, sowie des Claudius und Nero sind zu ihren Lebzeiten aus Furcht gefälscht, nach ihrem Tod mit frischem Hass geschildert worden“ (Annalen I, 1). Beide Herangehensweisen verzerren und entstellen die historische Wahrheit bis zur Unkenntlichkeit. Deshalb nimmt sich Tacitus vor „sine ira et studio – ohne Zorn und Eifer“, rein sachlich die Quellen auszuwerten und über seinen Gegenstand zu schreiben. Dies bedeutet bei Tacitus aber gerade nicht die Nivellierung von Besonderheiten oder gar Verharmlosung von Untaten. Im Gegenteil: Gerade durch die sachliche Exposition der vielfältigen Motive, Charakterzüge und Handlungsweisen gewinnen die historischen Personen ihr scharfes, manchmal auch Widersprüche umfassendes Profil. Der Historiker aber drängt sein moralisches Urteil der Nachwelt nicht auf, sondern überlässt es dem Leser, sich selbst ein Bild zu machen.
Auch die andere Seite soll gehört werden
Eng verwandt mit dieser Grundhaltung ist eine weitere, die bei Seneca so beschrieben wird: „Wer ein Urteil ohne Anhören der anderen Seite fällt, hat unrecht getan, selbst wenn sein Urteil gerecht wäre“ (Medea 199-200). Das hier angesprochene Prinzip „audiatur et altera pars – auch die Gegenseite soll gehört werden“ ist nicht nur ein Rechtsgrundsatz, sondern Kennzeichen guter wissenschaftlicher Praxis in der historischen Forschung. Trotz seines Zusammenhangs mit dem an zweiter Stelle genannten Prinzip der Unvoreingenommenheit geht diese Grundhaltung über die Forderung, dass ein Historiker sein moralisches Urteil zurückhalten sollte, hinaus: Wer die andere Seite erst gar nicht zu Wort kommen lässt, begeht ein Unrecht, weil so die Geschichte auf eine eindimensionale Story-Line reduziert wird. Ein solches Vorgehen kann prinzipiell der historischen Komplexität nicht gerecht werden.
Die zitierten Autoren sind, das sei betont, keine Wissenschaftler im heutigen Sinn gewesen. Sie haben aber mit den Prinzipien der genauen Quellenprüfung, der an der Sache orientierten Unvoreingenommenheit und dem Recht auf Gehör jeder Seite Grundsätze formuliert, hinter die gute wissenschaftliche Praxis in der Geschichtswissenschaft und ihren Hilfswissenschaften nicht zurückfallen darf. Daran muss sich gute historische Forschung, egal von welcher Seite sie betrieben wird, auch heute messen lassen.
Beiträge zu einem umfassenderen Bild in der Causa Kentenich
In Kooperation verschiedener Personen aus der Schönstatt-Bewegung werden im Auftrag des Generalpräsidiums des internationalen Schönstattwerkes Themen bearbeitet, die Pater Josef Kentenich, den Gründer der Bewegung, betreffen und die derzeit angefragt sind. Dies geschieht aufgrund des jeweiligen aktuellen Kenntnisstandes, der sich aus den zugänglichen Dokumenten und Schriften ergibt. Die Ergebnisse der Forschungen und Gespräche sind jeweils in themenbezogenen Artikeln zu lesen. Ihre Vorschläge für Themen weiterer Artikel können Sie gerne senden an: mk@schoenstatt.de.
PressOffice Schoenstatt International